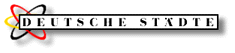Heiliges Römisches Reich war die offizielle Bezeichnung für den Herrschaftsbereich der römisch-deutschen Kaiser vom Mittelalter bis zum Jahre 1806. Der Name des Reiches leitet sich vom Anspruch der mittelalterlichen Herrscher ab, die Tradition des antiken Römischen Reiches fortzusetzen. Das Heilige Römische Reich ist der Ursprung der heutigen Nationalstaaten Deutschland und Österreich. Zur Unterscheidung von dem 1871 gegründeten Deutschen Reich bezeichnet die moderne historische Forschung es auch als „Altes Reich.”
Das Reich bildete sich im 10. Jahrhundert unter der Dynastie der Ottonen aus dem ehemals karolingischen Ostfrankenreich heraus. Der Name „Sacrum Imperium” ist für 1157 und der Titel „Sacrum Romanum Imperium” für 1254 erstmals urkundlich belegt. Seit dem 15. Jahrhundert setzte sich allmählich der Zusatz „Deutscher Nation” durch.
Aufgrund seines vor- und übernationalen Charakters entwickelte es sich nie zu einem Nationalstaat moderner Prägung, sondern blieb ein monarchisch geführtes, ständisch geprägtes Gebilde aus Kaiser und Reichsständen mit nur wenigen gemeinsamen Reichsinstitutionen.
Seit der Frühen Neuzeit war das Reich strukturell nicht mehr fähig zu kriegerischen Angriffen, Machterweiterung und Expansion. Seither wurden Rechtsschutz und Friedenswahrung als seine wesentlichen Zwecke angesehen. Das Reich sollte für Ruhe, Stabilität und die friedliche Lösung von Konflikten sorgen, indem es die Dynamik der Macht eindämmte: Untertanen sollte es vor der Willkür der Landesherren und kleinere Reichsstände vor Rechtsverletzungen mächtigerer Stände und des Kaisers schützen. Da seit 1648 auch benachbarte Staaten als Reichsstände in seine Verfassungsordnung integriert waren, erfüllte das Reich zudem eine friedenssichernde Funktion im System der europäischen Mächte.
Dass das Reich seit Mitte des 18. Jahrhunderts seine Glieder immer weniger gegen die expansive Politik innerer und äußerer Mächte zu schützen vermochte, war sein größtes Defizit und eine der Ursachen seines Untergangs. Durch die Eroberungen Napoleons und die daraus resultierende Gründung des Rheinbunds war es nahezu handlungsunfähig geworden. Das „Heilige Römische Reich Deutscher Nation” erlosch am 6. August 1806 mit der Niederlegung der Reichskrone durch Kaiser Franz II.

Kaiser und Reich in einer Darstellung aus dem 17. Jahrhundert. Im Zentrum ist Kaiser Ferdinand III. als „Haubt” des Reiches im Kreise der Kurfürsten abgebildet. Zu seinen Füßen sitzt eine Frauengestalt als Allegorie des Reiches, erkennbar an der Insignie des Reichsapfels. Die sie umgebenden Früchte symbolisieren die Hoffnung auf neuen Wohlstand nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. Kupferstich Teutschlands fröhliches zuruffen/zu glückseliger Fortsetztung/der mit Gott/in regensburg angestellten allgemeinen Versammlung des H.Röm. Reiches obersten Haubtes und Gliedern von Abraham Aubry, Nürnberg 1663/64.
Charakter des Reiches
Das „Heilige Römische Reich” war aus dem ostfränkischen Reich entstanden. Es war ein vor- und übernationales Gebilde, ein Lehnsreich und Personenverbandsstaat, der sich niemals zu einem Nationalstaat wie etwa Frankreich oder Großbritannien entwickelte und aus ideengeschichtlichen Gründen auch nie als solcher verstanden werden wollte.
Die Regierungsgewalt des Reiches lag weder allein in der Hand des Kaisers noch allein bei den Kurfürsten oder der Gesamtheit eines Personenverbandes wie dem Reichstag. Das Reich lässt sich weder als Bundesstaat noch als Staatenbund einordnen. Es war keine bloße Aristokratie, aber auch keine Oligarchie. Dennoch vereinigte das Reich Merkmale all dieser Staatsformen in sich. Die Geschichte des Reiches war geprägt durch den Streit über seinen Charakter. Ebenso wenig wie es jemals gelang, den regionalen Eigenwillen der einzelnen Territorien zu brechen, ist das Reich in einen losen Staatenbund zerfallen.
Das Reich überwölbte als „Dachverband” viele Territorien und gab dem Zusammenleben der verschiedenen Landesherrn reichsrechtlich vorgegebene Rahmenbedingungen. Diese quasi-selbstständigen, aber nicht souveränen Fürsten- und Herzogtümer erkannten den Kaiser als zumindest ideelles Reichsoberhaupt an und waren den Reichsgesetzen, der Reichsgerichtsbarkeit und den Beschlüssen des Reichstages unterworfen, gleichzeitig aber auch durch Königswahl, Wahlkapitulation, Reichstage und andere ständische Vertretungen an der Reichspolitik beteiligt und konnten diese für sich beeinflussen.
Im Gegensatz zu anderen Ländern waren die Bewohner nicht direkt dem Kaiser untertan. Jedes Reichsmitglied, also jedes Territorium, das reichsunmittelbar war, hatte seinen eigenen Landesherrn, im Falle der Reichsstädte den Magistrat.
Der Name des Reiches
Durch den Namen wurde der Anspruch auf die Nachfolge des antiken Römischen Reiches und damit gleichsam auf eine Universalherrschaft erhoben. Gleichzeitig hatte man Angst vor dem Eintreffen der Prophezeiungen des Propheten Daniel, der vorhersagte, dass es vier Weltreiche geben würde und danach der Antichrist auf die Erde kommen würde - die Apokalypse sollte beginnen. Daher durfte das Römische Reich nicht untergehen. Die Erhöhung durch den Zusatz „Heilig” betonte das Gottesgnadentum des Kaisertums und legitimierte die Herrschaft.
Mit der Krönung des Frankenkönigs Karl des Großen zum Kaiser durch Papst Leo III. im Jahr 800 stellte dieser sein Reich in die Nachfolge des antiken römischen Imperiums, die so genannte „Translatio Imperii”, obwohl geschichtlich und dem Selbstverständnis nach das christlich-orthodoxe byzantinische Reich aus dem alten römischen Reich entstanden war; nach Ansicht der Byzantiner war das neue westliche „Römische Reich” ein selbsternanntes und illegitimes.
Interessanterweise trug das Reich zum Zeitpunkt seiner Entstehung Mitte des 10. Jahrhunderts noch nicht das Prädikat heilig. Der erste Kaiser Otto I. und seine Nachfolger sahen sich selbst und wurden als Stellvertreter Gottes auf Erden und damit als erste Beschützer der Kirche angesehen. Es bestand also keine Notwendigkeit, die „Heiligkeit” des Reiches besonders hervorzuheben. Das Reich hieß weiterhin „Regnum Francorum orientalium” oder kurz „Regnum Francorum”.

Die Reichskrone auf einem Stich von Johann Adam Delsenbach
In den Kaisertitulaturen der Ottonen tauchen die später auf das gesamte Reich übertragenen Namensbestandteile aber schon auf. So findet sich in den Urkunden Ottos II. aus dem Jahre 982, die während seines Italienfeldzuges entstanden, die Titulatur „Romanorum imperator augustus”, „Kaiser der Römer”. Und Otto III. erhöhte sich in seiner Titulatur über alle geistlichen und weltlichen Mächte, indem er sich, analog zum Papst und sich damit über diesen erhebend, demutsvoll „Knecht Jesu Christi” und später sogar „Knecht der Apostel” nannte.
Erst nachdem die sakrale Ausstrahlung des Kaisertums durch den Investiturstreit von 1075 bis 1122 weitgehend verblasst war, versuchten die Kaiser diesen Anspruch nunmehr verbal für sich zu reklamieren. So entstand im 12. Jahrhundert in der Kanzlei Friedrichs I., genannt Barbarossa, der Begriff des „sacrum imperium”. Vielleicht handelte es sich hierbei um eine bewusste Wiederaufnahme spätantiker römischer Traditionen. Dies ist in der Forschung aber umstritten, da es sich auch um einen speziell „staufischen” Begriff handeln könnte, zumal in der Antike nicht das Römerreich selbst als „sacrum” galt, sondern nur die Person des Kaisers.
Im so genannten Interregnum von 1250 bis 1273, als es keinem der drei gewählten Könige gelang, sich gegen die anderen durchzusetzen, verband sich der Anspruch, der Nachfolger des Römischen Reiches zu sein, mit dem Prädikat heilig zur Bezeichnung „Sacrum Romanum Imperium” (deutsch „Heiliges Römisches Reich”). Die lateinische Wendung „Sacrum Imperium Romanum” ist erstmals 1254 belegt, in deutschsprachigen Urkunden trat sie rund hundert Jahre später seit der Zeit Kaiser Karls IV. auf. Ausgerechnet während der kaiserlosen Zeit Mitte des 13. Jahrhunderts wurde der universale Machtanspruch also umso tönender angemeldet – wenn sich freilich auch in der nachfolgenden Zeit daran wenig änderte.
Der Zusatz „Nationis Germanicae” erschien erst im Spätmittelalter um 1450, wohl auch weil sich das Reich im Wesentlichen auf das Gebiet des deutschen Sprachraumes erstreckte. 1486 wurde diese Titulatur im Landfriedensgesetz Kaiser Friedrichs III. verwendet. Erstmals offiziell verwendet wurde dieser Zusatz im Jahre 1512 in der Präambel des Abschieds des Reichstages in Köln. Kaiser Maximilian I. hatte die Reichsstände unter anderem zwecks „Erhaltung des Heiligen Römischen Reiches Teutscher Nation” geladen.
Bis 1806 war „Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation” die offizielle Bezeichnung des Reiches, die oft als „SRI” für „Sacrum Romanum Imperium” auf lateinisch oder „H. Röm. Reich” auf Deutsch abgekürzt wurde.
Die beiden letzten großen Rechtsakte das Reich betreffend, der Reichsdeputationshauptschluss von 1803 und die Auflösungserklärung Kaiser Franz II., verwenden jedoch dann den Begriff „deutsches Reich”. Von Heiligkeit oder universaler Macht konnte ohnehin schon lange keine Rede mehr sein.
Geschichte
Entstehung des Reiches
Das Fränkische Reich hatte nach dem Tode Karl des Großen im Jahre 814 mehrfach Teilungen und Wiedervereinigungen der Reichsteile unter seinen Kindern und Enkeln durchlaufen. Solche Teilungen unter den Söhnen eines Herrschers waren nach fränkischem Recht normal und bedeuteten nicht, dass die Einheit des Reiches aufhörte zu existieren, da eine gemeinsame Politik der Reichsteile und eine künftige Wiedervereinigung weiterhin möglich war. Starb einer der Erben kinderlos, so fiel dessen Reichsteil einem seiner Brüder zu.
Solch eine Teilung wurde auch im Vertrag von Verdun 843 unter den Enkeln Karls beschlossen. Das Reich wurde zwischen Karl dem Kahlen, der den westlichen romanisierten Teil bis etwa zur Maas erhielt, Ludwig dem Deutschen – er erhielt den östlichen, eher germanisch geprägten Reichsteil – und Lothar I., der neben der Kaiserwürde den mittleren Streifen von der Nordsee bis zum Mittelmeer erhielt, aufgeteilt.
Auch wenn hier, von den Beteiligten nicht beabsichtigt, die zukünftige Landkarte Europas erkennbar ist, kam es im Laufe der nächsten fünfzig Jahre zu weiteren, meist kriegerischen, Wiedervereinigungen und Teilungen zwischen den Teilreichen. Erst als Karl der Dicke 887 wegen seines Versagens beim Abwehrkampf gegen die plündernden und raubenden Normannen abgesetzt wurde, wurde kein neues Oberhaupt aller Reichsteile mehr bestimmt, sondern die verbliebenen Teilreiche wählten sich eigene Könige. Diese gehörten teilweise nicht mehr der Dynastie der Karolinger an. Dies war ein deutliches Zeichen für das Auseinanderdriften der Reichsteile und das auf dem Tiefpunkt angekommene Ansehen der Karolingerdynastie, da diese das Reich in Folge der Thronstreitigkeiten in Bürgerkriege stürzte und nicht in der Lage war, das Gesamtreich gegen äußere Bedrohungen zu schützen. Infolge der nun fehlenden dynastischen Klammer zerfiel das Reich in zahlreiche kleine Grafschaften, Herzogtümer und andere regionale Herrschaften, die meist nur noch formal die regionalen Könige als Oberhoheit anerkannten.
Besonders deutlich setzte der Zerfall im mittleren Reichsteil ein, in dem sich die Stammesherzogtümer herausbildeten: Nicht mehr der König ernannte die Herzöge, sondern die lokalen Adligen wählten sie. Im östlichen Reich konnte diese Entwicklung nach dem Tode des letzten Karolingers auf dem ostfränkischen Thron, Ludwigs des Kindes, durch die gemeinsame Wahl Konrads I. aufgehalten werden. Konrad gehörte zwar nicht der Dynastie der Karolinger an, war aber ein Franke aus dem Geschlecht der Konradiner. Trotz der Abkehr der Lothringer vom ostfränkischen Reich, die sich den Westfranken anschlossen, zeigte die Wahl Konrads endgültig, wie stark sich Ostfranken vom Gesamtreich abgewendet hatte. Im Jahre 918 wurde diese Entwicklung noch deutlicher, als mit dem Sachsenherzog Heinrich I. erstmals ein Nicht-Franke zum ostfränkischen König gewählt wurde. Seit diesem Zeitpunkt trug nicht mehr eine einzige Dynastie das Reich, sondern die regionalen Großen, Adligen und Herzöge entschieden über den Herrscher.
Im Jahre 921 erkannte der westfränkische Herrscher im Vertrag von Bonn Heinrich I. als gleichberechtigt an, er durfte den Titel „rex francorum orientalium”, König der östlichen Franken, führen. Die Entwicklung des Reiches als eines auf Dauer eigenständigen und überlebensfähigen Staatswesens war damit im Wesentlichen abgeschlossen.
Trotz der Ablösung vom Gesamtreich und der Vereinigung der germanischen Völkerschaften, die im Gegensatz zu Westfranken nicht romanisiertes Latein, sondern „theodiscus” oder „diutisk” (von „diot” volksmäßig, volkssprachig) sprachen, war dieses Reich kein früher deutscher Nationalstaat. Genauso wenig war es bereits das spätere Heilige Römische Reich.
Das steigende Selbstbewusstsein des neuen ostfränkischen Königsgeschlechtes zeigte sich bereits in der Thronbesteigung Ottos I., des Sohnes Heinrichs, der auf dem vermeintlichen Thron Karls des Großen in Aachen gekrönt wurde. Hier zeigte sich der zunehmend sakrale Charakter seiner Herrschaft dadurch, dass er sich salben ließ und der Kirche seinen Schutz gelobte. Nach einigen Kämpfen gegen Verwandte und lothringische Herzöge gelang ihm mit dem Sieg über die Ungarn 955 auf dem Lechfeld bei Augsburg die Bestätigung und Festigung seiner Herrschaft. Noch auf dem Schlachtfeld soll ihn das Heer der Legende nach als „Imperator” gegrüßt haben.
Dieser Sieg über die Ungarn veranlasste Papst Johannes XII., Otto nach Rom zu rufen und ihm die Kaiserkrone anzubieten, damit dieser als Beschützer der Kirche auftrete. Johannes stand zu diesem Zeitpunkt unter der Bedrohung regionaler italienischer Könige und erhoffte sich von Otto Hilfe gegen diese. Aber der Hilferuf des Papstes bekundet auch, dass die ehemaligen Barbaren sich zu den Trägern der römischen Kultur gewandelt hatten, und, dass das östliche „regnum” als legitimer Nachfolger des Kaisertums Karls des Großen angesehen wurde. Otto folgte dem Ruf, auch wenn es wohl Irritation unter einigen Beratern des Königs gab, und zog nach Rom. Er wollte der Beschützer der Kirche sein.
Als „Gründungsdatum” des Heiligen Römischen Reiches wird von Historikern meist das Datum der Kaiserkrönung Ottos I. am 2. Februar 962 angegeben, auch wenn Otto kein neues Reich gründen wollte oder gegründet hat und das Reich auch erst einige Jahrhunderte später diesen Namen trug. Spätestens hier ist der Prozess der Herauslösung des ostfränkischen Reiches als eigenständiges Reich aus dem fränkischen Gesamtreich abgeschlossen. Das Reich hatte seine weltliche und sakrale Legitimation als neues „Imperium Romanum” durch die Kaiserkrönung erhalten.
Mittelalter
Das Reich unter den Ottonen
Das Reich ist zu dieser Zeit eine im Vergleich zum Spät- und Hochmittelalter ständisch und gesellschaftlich noch wenig ausdifferenzierte Gesellschaft. Das Reich wurde sichtbar im Heeresaufgebot, in den lokalen Gerichtsversammlungen und in den Grafschaften, den bereits von den Franken installierten lokalen Verwaltungseinheiten. Oberster Repräsentant der politischen Ordnung des Reiches, zuständig für den Schutz des Reiches und den Frieden im Inneren, war der König. Als politische Untereinheiten dienten die Herzogtümer.
Entstanden aus der territorialen Zusammenfassung der durch die Franken unterworfenen Völker und geleitet durch fränkische Amtsherzöge, gab es im Reich ursprünglich fünf Herzogtümer: das der Sachsen, der Baiern, der Alemannen, der Franken und das nach der Reichsteilung neu entstandene Herzogtum Lothringen, zu dem auch die Friesen gehörten. Doch schon im 10. Jahrhundert ergaben sich gravierende Änderungen der Struktur der Herzogtümer: Lothringen wurde 965 in Nieder- und Oberlothringen aufgeteilt und Kärnten wurde 976 ein eigenständiges Herzogtum.
Da das Reich als Instrument der selbstbewussten Herzogtümer entstanden war, wurde es nicht mehr zwischen den Söhnen des Herrschers aufgeteilt und blieb zudem eine Wahlmonarchie. Die Nichtaufteilung des „Erbes” zwischen den Söhnen des Königs widersprach eigentlich dem überkommenen fränkischen Recht. Dementsprechend legte Heinrich I. 929 in seiner Hausordnung fest, dass nur ein Sohn auf dem Thron nachfolgen solle. Schon hier werden der das Reich bis zum Ende der Salier-Dynastie prägende Erbgedanke und das Prinzip der Wahlmonarchie miteinander verbunden.
Otto I. gelang es infolge mehrerer Feldzüge nach Italien, den nördlichen Teil der Halbinsel zu erobern und das Königreich der Langobarden beziehungsweise Italiener ins Reich einzubinden. Eine vollständige Integration Reichsitaliens gelang allerdings nie wirklich.
Unter Otto II. lösten sich auch die letzten verbliebenen Verbindungen zum westfränkisch-französischen Reich, die in Form von Verwandtschaftsbeziehungen noch bestanden, als er seinen Vetter Karl zum Herzog von Niederlotharingien machte. Karl war ein Nachkomme aus dem Geschlecht der Karolinger und gleichzeitig der jüngere Bruder des westfränkischen Königs Lothar. Es wurde aber nicht – wie später in der Forschung behauptet – ein „treuloser Franzose” ein Lehnsmann eines „deutschen” Königs. Solche Denkkategorien waren zu jener Zeit noch unbekannt. Vielmehr spielte Otto den einen Vetter gegen den anderen aus, um für sich einen Vorteil zu erlangen, indem er einen Keil in die karolingische Familie trieb. Die Reaktion Lothars war heftig, und beide Seiten luden den Streit emotional auf. Die Folgen dieses endgültigen Bruches zwischen den Nachfolgern des Fränkischen Reiches zeigten sich aber erst später. Das französische Königtum wurde auf Grund des sich herausbildenden französischen Selbstbewusstseins aber nunmehr als unabhängig vom Kaiser angesehen.

Heinrich II. und Kunigunde von Christus gekrönt, Darstellung aus dem Perikopenbuch Heinrichs II.
Die unter den ersten drei Ottonen begonnene Einbindung der Kirche in das weltliche Herrschaftssystem des Reiches, später von Historikern als „Ottonisch-salisches Reichskirchensystem” bezeichnet, fand unter Heinrich II. ihren Höhepunkt. Das Reichskirchensystem bildete bis zum Ende des Reiches eines der prägenden Elemente seiner Verfassung. Heinrich verlangte von den Klerikern unbedingten Gehorsam und die unverzügliche Umsetzung seines Willens. Er vollendete die Königshoheit über die Reichskirche und wurde zum „Priesterkönig” wie kaum ein zweiter Herrscher des Reiches. Doch er regierte nicht nur die Kirche, er regierte das Reich auch durch die Kirche, indem er wichtige Ämter – wie etwa das des Kanzlers – mit Bischöfen besetzte. Weltliche und kirchliche Angelegenheiten wurden im Grunde genommen nicht unterschieden und gleichermaßen auf Synoden verhandelt. Dies resultierte aber nicht nur aus dem Bestreben, dem aus fränkisch-germanischer Tradition herrührenden Drang der Herzogtümer nach größerer Selbstständigkeit ein königstreues Gegengewicht entgegenzusetzen. Vielmehr sah Heinrich das Reich als „Haus Gottes” an, das er als Verwalter Gottes zu betreuen hatte. Spätestens jetzt war das Reich „heilig”.
Hochmittelalter
Als dritter wichtiger Reichsteil kam unter Konrad II. das Königreich Burgund zum Reich, auch wenn diese Entwicklung schon unter Heinrich II. begann. König Rudolf III. besaß keine Nachkommen und benannte deshalb seinen Neffen Heinrich zu seinem Nachfolger und stellte sich unter den Schutz des Reiches. Im Jahre 1018 übergab er sogar seine Krone und das Zepter an Heinrich.
Die Herrschaft Konrads war weiterhin durch die sich entwickelnde Vorstellung gekennzeichnet, dass das Reich und dessen Herrschaft unabhängig vom Herrscher existiert und Rechtskraft entwickelt. Belegt ist dies durch die bekannte „Schiffsmetapher” Konrads (siehe entsprechenden Abschnitt im Artikel über Konrad II.) und durch seinen Anspruch auf Burgund - denn eigentlich sollte ja Heinrich Burgund erben und nicht das Reich. Unter Konrad begann auch die Herausbildung der Ministerialen als eigener Stand des unteren Adels, indem er an die eigentlich unfreien Dienstmannen des Königs Lehen vergab. Wichtig für die Entwicklung des Rechtes im Reich waren seine Versuche, die so genannten Gottesurteile als Rechtsmittel durch die Anwendung römischen Rechtes, dem diese Urteile unbekannt waren, im nördlichen Reichsteil zurückzudrängen.
Konrad setzte zwar die Reichskirchenpolitik seines Vorgängers fort, allerdings nicht mit dessen Vehemenz. Er beurteilte die Kirche eher danach, was diese für das Reich tun konnte. In der Mehrzahl berief er Bischöfe und Äbte mit großer Intelligenz und Spiritualität. Der Papst spielte allerdings auch bei seinen Berufungen keine große Rolle. Insgesamt erscheint seine Herrschaft als große „Erfolgsgeschichte”, was wohl auch daran liegt, dass er in einer Zeit herrschte, in der allgemein eine Art Aufbruchsstimmung herrschte, die Ende des 11. Jahrhunderts in die Cluniazensische Reform mündete.
Heinrich III. übernahm 1039 von seinem Vater Konrad ein gefestigtes Reich und musste sich im Gegensatz zu seinen beiden Vorgängern seine Macht nicht erst erkämpfen. Heinrich legte trotz kriegerischer Aktionen in Polen und Ungarn sehr großen Wert auf die Friedenswahrung innerhalb des Reiches. Diese Idee eines allgemeinen Friedens, eines Gottesfriedens, entstand in Südfrankreich und hatte sich seit Mitte des 11. Jahrhunderts über das ganze christliche Abendland verbreitet. Damit sollten das Fehdewesen und die Blutrache eingedämmt werden, die immer mehr zu einer Belastung für das Funktionieren des Reiches geworden waren. Initiator dieser Bewegung war das cluniazensische Mönchstum. Wenigstens an den höchsten christlichen Feiertagen und an den Tagen, die durch die Passion Christi geheiligt waren, also von Mittwochabend bis Montagmorgen, sollten die Waffen schweigen und der „Gottesfrieden” herrschen.
Heinrich III. musste für die Zustimmung der Großen des Reiches bei der Wahl seines Sohnes, des späteren Heinrichs IV., zum König im Jahre 1053 eine bis dahin völlig unbekannte Bedingung akzeptieren. Die Unterordnung unter den neuen König sollte nur gelten, wenn sich Heinrich IV. als rechter Herrscher erweise. Auch wenn die Macht der Kaiser über die Kirche mit Heinrich III. auf einem ihrer Höhepunkte war – er war es gewesen, der über die Besetzung des heiligen Throns in Rom bestimmte -, so wird die Bilanz seiner Herrschaft meist negativ gesehen. So emanzipierte sich Ungarn vom Reich, das vorher noch Reichslehen war, und mehrere Verschwörungen gegen den Kaiser zeigten den Unwillen der Großen des Reiches, sich einem starken Königtum unterzuordnen.
Durch den frühen Tod Heinrichs III. gelangte sein erst sechsjähriger Sohn Heinrich IV. auf den Thron. Für ihn übernahm seine Mutter Agnes die Vormundschaft bis zu seinem 15. Lebensjahr 1065. Es kam hierdurch zu einem schleichenden Macht- und Bedeutungsverlust des Königtums. In Rom interessierte die Meinung des künftigen Kaisers schon bei der nächsten Papstwahl niemanden mehr. Der Annalist des Klosters Niederaltaich fasste die Situation folgendermaßen zusammen:
[...] die bei Hofe Anwesenden aber sorgten jeder für sich selbst, so viel sie nur konnten, und niemand unterwies den König darin, was gut und gerecht sei, so daß im Königreich vieles in Unordnung geriet
Entscheidend für die zukünftige Stellung der Reichskirche wurde der so genannte Investiturstreit. Für die römisch-deutschen Herrscher war es selbstverständlich, dass sie die vakanten Bischofssitze im Reich neu besetzten. Durch die Schwäche des Königtums während der Regentschaft von Heinrichs Mutter hatten der Papst, aber auch geistliche und weltliche Fürsten versucht, sich königliche Besitzungen und Rechte anzueignen. Die späteren Versuche, der Königsmacht wieder Geltung zu verschaffen, trafen natürlich auf wenig Gegenliebe. Als Heinrich im Juni 1075 versuchte, seinen Kandidaten für den Mailänder Bischofssitz durchzusetzen, reagierte Papst Gregor VII. sofort. Im Dezember 1075 bannte Gregor König Heinrich und entband damit alle Untertanen von ihrem Treueid. Die Fürsten des Reiches forderten von Heinrich, dass er bis Februar 1077 den Bann lösen lassen sollte, ansonsten würde er von ihnen nicht mehr anerkannt. Im anderen Falle würde der Papst eingeladen, den Streit zu entscheiden. Heinrich IV. musste sich beugen und demütigte sich im legendären Gang nach Canossa. Die Machtpositionen hatten sich in ihr Gegenteil verkehrt; 1046 hatte Heinrich III. noch über drei Päpste gerichtet, nun sollte ein Papst über den König richten.

Höhepunkt des Investiturstreits:
Heinrich bittet Mathilde von Tuszien und Abt Hugo von Cluny um Vermittlung, worauf der Gang nach Canossa, eine Burg der Mathilde, die Exkommunikation Heinrichs IV. beenden sollte.
Der Sohn Heinrichs IV. empörte sich mit Hilfe des Papstes gegen seinen Vater und erzwang 1105 dessen Abdankung. Der neue König Heinrich V. wurde allerdings erst nach dem Tod Heinrichs IV. allgemein anerkannt. Als er sich dieser Anerkennung gewiss war, stellte er sich gegen den Papst und setzte die antipäpstliche Reichspolitik seines Vaters fort. Er führte zunächst den Investiturstreit seines Vaters gegen Rom weiter und erreichte 1122 im Wormser Konkordat einen Ausgleich mit dem amtierenden Papst Kalixt II. Heinrich V., der zuvor wie selbstverständlich die Bischöfe im Reich mit Ring und Stab investiert hatte, akzeptierte den Anspruch der Kirche auf das Recht zur Investitur.
Die gefundene Lösung war einfach und radikal. Um die von den Kirchenreformern geforderte Trennung der geistlichen Aufgaben der Bischöfe von den bisher wahrgenommenen weltlichen Aufgaben zu gewährleisten, sollten die Bischöfe ihre in den letzten Jahrhunderten vom Kaiser beziehungsweise König erhaltenen Rechte und Privilegien zurückgeben. Einerseits entfielen damit die Pflichten der Bischöfe gegenüber dem Reich, andererseits auch das Recht des Königs, bei der Einsetzung der Bischöfe Einfluss nehmen zu können. Da die Bischöfe aber nicht auf ihre weltlichen Regalien verzichten wollten, zwang Heinrich den Papst einer Kompromisslösung zuzustimmen. Die Wahl der deutschen Bischöfe und Äbte sollte in Gegenwart kaiserlicher Abgeordneter verhandelt, der Gewählte aber mit den Regalien, die mit seinem geistlichen Amt verbunden waren, vom Kaiser durch das Zepter belehnt werden. Der Bestand der Reichskirche war damit gesichert, der Einfluss des Kaisers auf diese aber stark geschwächt worden.
Nach dem Tod Heinrichs V. 1125 wurde Lothar III. zum König gewählt, wobei sich gegen die Wahl starker Widerstand formierte. Die Staufer, die Heinrich V. beigestanden waren, hatten sich berechtigte Hoffnungen auf die Königswürde gemacht. Bis 1135 dauerte der Widerstand der Staufer gegen Lothar und die diesen unterstützenden Welfen an. Die Rivalität zwischen Staufern und Welfen wurde weiter geschürt, als 1138 der Staufer Konrad zum König erhoben wurde. Konrads Wunsch, die Kaiserkrone zu erwerben, sollte sich jedoch nicht erfüllen. Auch seine Teilnahme am Zweiten Kreuzzug hatte keinen Erfolg, er musste noch in Kleinasien umkehren. Dafür gelang ihm ein gegen die Normannen gerichtetes Bündnis mit dem byzantinischen Kaiser Manuel I. Komnenos.
1152 wurde nach dem Tod Konrads dessen Neffe Friedrich, der Herzog von Schwaben, zum König gewählt. Friedrich, genannt „Barbarossa”, betrieb eine zielstrebige Politik, die auf die Rückgewinnung kaiserlicher Rechte in Italien gerichtet war, deretwegen Friedrich insgesamt sechs Italienzüge unternahm. 1155 wurde er zum Kaiser gekrönt, doch kam es aufgrund eines nicht erfolgten, aber vertraglich zugesicherten Feldzugs gegen das Normannenreich in Unteritalien zu Spannungen mit dem Papsttum, ebenso verschlechterten sich die Beziehungen zu Byzanz. Auch die oberitalienischen Stadtstaaten, besonders das reiche und mächtige Mailand, leisteten Friedrichs Versuchen Widerstand, die Reichsverwaltung in Italien zu stärken. Es kam schließlich zur Bildung des sogenannten Lombardenbundes, der sich militärisch gegen den Staufer durchaus behaupten konnte. Gleichzeitig war es zu einer umstrittenen Papstwahl gekommen, wobei der mit der Mehrheit der Stimmen gewählte Papst Alexander III. von Friedrich zunächst nicht anerkannt wurde. Erst nachdem abzusehen war, dass eine militärische Lösung keine Aussicht auf Erfolg hatte (1167 hatte im kaiserlichen Heer vor Rom eine Seuche gewütet, 1176 Niederlage in der Schlacht von Legnano), kam es endlich im Frieden von Venedig 1177 zu einer Einigung zwischen Kaiser und Papst. Auch die oberitalienischen Städte und der Kaiser verständigten sich, wobei Friedrich jedoch längst nicht alle seine Ziele verwirklichen konnte.

Friedrich Barbarossa mit seinen Söhnen König Heinrich und Herzog Friedrich.
Miniatur aus der Welfenchronik
(Kloster Weingarten, 1179-1191).
Heute Landesbibliothek Fulda
Im Reich hatte sich der Kaiser mit seinem Cousin Heinrich überworfen, dem mächtigen Herzog von Sachsen und Bayern aus dem Hause der Welfen, nachdem beide sich Jahre zuvor gemeinsam verständigt hatten. Als Heinrich nun jedoch seine Teilnahme an einem Italienzug an Bedingungen knüpfte, nahm Friedrich dies zum Vorwand, um Heinrich zu entmachten. 1180 wurde Heinrich der Prozess gemacht und das Herzogtum Sachsen zerschlagen sowie Bayern verkleinert, wovon jedoch weniger der Kaiser als vielmehr die Territorialherren im Reich profitierten.
Der Kaiser verstarb im Juni 1190 in Kleinasien während eines Kreuzzugs. Seine Nachfolge trat sein zweitältester Sohn Heinrich VI. an. Dieser war schon 1186 von seinem Vater zum „Caesar” erhoben worden und galt seitdem als designierter Nachfolger Friedrichs. 1191, im Jahr seiner Kaiserkrönung, versuchte Heinrich, das Normannenkönigreich in Unteritalien und Sizilien in Besitz zu nehmen. Da er mit einer Normannenprinzessin verheiratet war und das dort herrschende Haus Hauteville in der Hauptlinie ausgestorben war, konnte er auch Ansprüche geltend machen, die militärisch zunächst aber nicht durchsetzbar waren. Erst 1194 gelang die Eroberung Unteritaliens, wo Heinrich mit teils äußerster Brutalität gegen oppositionelle Kräfte vorging. In Deutschland hatte Heinrich gegen den Widerstand der Welfen zu kämpfen - 1196 scheiterte sein Erbreichsplan. Dafür betrieb er eine ehrgeizige und recht erfolgreiche „Mittelmeerpolitik”, deren Ziel vielleicht die Eroberung des Heiligen Landes oder womöglich sogar eine Offensive gegen Byzanz war.
Nach dem frühen Tod Heinrichs VI. 1197 scheiterte der letzte Versuch, im Reich eine starke Zentralgewalt zu schaffen. Nach der Doppelwahl von 1198, bei der Philipp von Schwaben im März in Mühlhausen/Thüringen und Otto IV. im Juni in Köln gewählt wurden, standen sich zwei Könige im Reich gegenüber. Der Sohn Heinrichs, Friedrich II., war zwar schon 1196 im Alter von zwei Jahren zum König gewählt worden, seine Ansprüche wurden aber beiseite gewischt. Dennoch ist diese Wahl bemerkenswert. Der Streit um den Thron fiel mit einer Phase beschleunigter Verschriftlichung und Verrechtlichung zusammen, so dass neben die kriegerischen Auseinandersetzungen eine juristische Komponente trat. Man erhob Präzedenzfälle zu Beispielen der eigenen Rechtmäßigkeit und passte hergebrachte Traditionen der Situation entsprechend an. Viele Argumente und Grundsätze, die für die folgenden Königswahlen gelten sollten, wurden in jener Zeit formuliert. Diese Entwicklung gipfelte Mitte des 14. Jahrhunderts nach den Erfahrungen des Interregnums in den Festlegungen der Goldenen Bulle. Philipp hatte sich schon weitgehend durchgesetzt, als er im Juni 1208 ermordet wurde.
Dass sich Friedrich II., der 1212 nach Deutschland gereist war, um dort seine Rechte durchzusetzen, auch nach seiner Anerkennung nur wenige Jahre seines Lebens und damit seiner Regierungszeit im deutschen Reich aufhielt, gab den Fürsten wieder mehr Handlungsspielräume. Friedrich verbriefte den weltlichen Fürsten im „Statutum in favorem principum” und den geistlichen in der „Confoederatio cum principibus ecclesiasticis” weitgehende Rechte, um sich von ihnen die Zustimmung zur Wahl und Anerkennung seines Sohnes Heinrich als römisch-deutscher König zu sichern. Diese Privilegien bildeten für die Fürsten die rechtliche Grundlage, auf der sie ihre Macht zu geschlossenen, eigenständigen Landesherrschaften ausbauen konnten; sie waren der Beginn der spätmittelalterlichen Staatswerdung auf der Ebene der Territorien im Reich.
In Italien war der hochgebildete Friedrich II., der die Verwaltung des Königreichs Sizilien nach byzantinischem Vorbild immer stärker zentralisierte, über Jahre in einen Konflikt mit dem Papsttum und den oberitalienischen Städten verwickelt, wobei Friedrich gar als Anti-Christ verunglimpft wurde. Am Ende schien Friedrich militärisch die Oberhand gewonnen zu haben, da verstarb der Kaiser, der vom Papst 1245 für abgesetzt erklärt worden war, am 13. Dezember 1250.
Spätmittelalter
Im Spätmittelalter verfiel im Zuge des Untergangs der Staufer und des darauffolgenden Interregnums bis in die Zeit Rudolfs von Habsburg die allerdings traditionell nur schwach ausgeprägte Zentralgewalt, während die Macht der Kurfürsten weiter zunahm. Die französische Expansion im westlichen Grenzgebiet des Imperiums hatte zur Folge, dass die Einflussmöglichkeiten des Königtums im ehemaligen Königreich Burgund auf einen faktischen Nullpunkt sanken; eine ähnliche, aber weniger stark ausgeprägte Tendenz zeichnete sich in „Reichsitalien” (also im Wesentlichen in der Lombardei und der Toskana) ab. Erst mit dem Italienzug Heinrichs VII. (1310–1313) kam es zu einer zaghaften Wiederbelebung der kaiserlichen Italienpolitik; Heinrich war nach Friedrich II. auch der erste römisch-deutsche König, der auch die Kaiserkrone erlangen konnte. Die Italienpolitik der spätmittelalterlichen Herrscher verlief aber in wesentlich engeren Grenzen als die ihrer hochmittelalterlichen Vorgänger.
Dabei gerieten die Könige erneut in Konflikt mit den Päpsten, die seit 1309 in Avignon residierten. Im Laufe dieser Auseinandersetzungen, die besonders in der Zeit Ludwigs des Bayern an Intensität zunahmen, kam es auch zu einer verstärkten Emanzipation der Kurfürsten beziehungsweise des Königs vom Papsttum, was im Kurverein von Rhense seinen Ausdruck fand.
Die spätmittelalterlichen Könige konzentrierten sich wesentlich stärker auf den deutschen Reichsteil, wobei sie sich gleichzeitig stärker als zuvor auf ihre jeweilige Hausmacht stützten; Kaiser Karl IV. kann dabei als ein Musterbeispiel angeführt werden. Karl IV. gelang auch ein weitgehender Ausgleich mit dem Papsttum - er schuf mit der Goldenen Bulle von 1356 eines der wichtigsten „Reichsgrundgesetze”, in dem die Rechte der Kurfürsten endgültig festgelegt wurden und die maßgeblich die künftige Politik des Reiches mitbestimmten.
Die Goldene Bulle blieb bis zur Auflösung des Reiches in Kraft. In Karls Regierungszeit fiel auch der Ausbruch des so genannten „Schwarzen Todes” - der Pest -, die zu einer schweren Krisenstimmung beitrug und in deren Verlauf es zu einem deutlichen Rückgang der Bevölkerung sowie zu Judenpogromen kam. Gleichzeitig stellte diese Zeit aber auch die Blütezeit der Hanse dar, die zu einer Großmacht im nordeuropäischen Raum wurde.
Mit dem Tod Karls 1378 ging die von ihm begründete Machtstellung der Luxemburger im Reich bald verloren, da der von ihm geschaffene Hausmachtskomplex rasch zerfiel. Sein Sohn Wenzel wurde wegen seiner offensichtlichen Unfähigkeit gar von einer Gruppe von Kurfürsten am 20. August 1400 abgesetzt.

Seite aus einer Handschrift der Goldenen Bulle, die 1400 von König Wenzel in Auftrag gegeben wurde,
links: der Kaiser mit einer blauen Tunika bekleidet,
vom Künstler wurden diesem sechs Kurfürsten beigesellt, was aber der Sitzordnung in der Goldenen Bulle widerspricht, rechts: der Kölner Erzbischof als Kurfürst
Statt seiner wurde der Pfalzgraf bei Rhein, Ruprecht, zum neuen König gewählt. Seine Machtbasis und Ressourcen waren jedoch zu gering, um eine wirkungsvolle Regierungstätigkeit entfalten zu können, zumal die Luxemburger sich mit dem Verlust der Königswürde nicht abfanden. Nach Ruprechts Tod 1410 gelangte schließlich mit Sigismund der letzte Luxemburger auf den Thron.
Hinzu traten kirchenpolitische Probleme wie das Abendländische Schisma, das erst unter Sigismund unter Rückgriff auf den Konziliarismus beseitigt werden konnte. Mit dem Tod Sigismunds 1437 erlosch das Haus Luxemburg in direkter Linie. Die Königswürde ging nun auf die Habsburger über, die sie fast durchgehend bis zum Ende des Reiches behaupten konnten.
Frühe Neuzeit
Reichsreform
Von Historikern wird das frühneuzeitliche Kaisertum des Reiches als Neuanfang und Neuaufbau angesehen und keinesfalls als Widerschein der staufischen hochmittelalterlichen Herrschaft. Denn der Widerspruch zwischen der beanspruchten Heiligkeit, dem globalen Machtanspruch des Reiches und den realen Möglichkeiten des Kaisertums war in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu deutlich geworden. Dies löste eine publizistisch unterstützte Reichsverfassungsbewegung aus, die zwar die alten „heilen Zustände” wieder aufleben lassen sollte, letztendlich aber zu durchgreifenden Innovationen führte.
Unter den Habsburgern Friedrich III., Maximilian I. und Karl V. kam das Kaisertum nach seinem Niedergang wieder zu Anerkennung, das Amt des Kaisers wurde fest mit der neu geschaffenen Reichsorganisation verbunden. Der Reformbewegung entsprechend initiierte Maximilian 1495 eine umfassende Reichsreform, die einen Ewigen Landfrieden, eines der wichtigsten Vorhaben der Reformbefürworter, und eine reichsweite Steuer, den Gemeinen Pfennig, vorsah. Zwar gelang es nicht vollständig, diese Reformen umzusetzen, denn von den Institutionen, die aus ihr hervorgingen, hatten nur die neugebildeten Reichskreise und das Reichskammergericht Bestand. Dennoch war die Reform die Grundlage für das neuzeitliche Reich. Es erhielt mit ihr ein wesentlich präziseres Regelsystem und ein institutionelles Gerüst. Das nunmehr festgelegte Zusammenspiel zwischen Kaiser und Reichsständen sollte prägend für die Zukunft werden. Der Reichstag bildete sich ebenfalls zu jener Zeit heraus und war bis zu seinem Ende das zentrale politische Forum des Reiches.
Reformation und Religionsfrieden
Die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts war auf der einen Seite geprägt durch eine weitere Verrechtlichung und damit eine weitere Verdichtung des Reiches, so beispielsweise durch Erlasse von Reichspolizeiordnungen 1530 und 1548 und der Constitutio Criminalis Carolina im Jahre 1532. Auf der anderen Seite wirkte die in dieser Zeit durch die Reformation entstandene Glaubensspaltung desintegrierend. Dass sich einzelne Regionen und Territorien von der alten römischen Kirche abwandten, stellte das Reich, nicht zuletzt wegen seines Heiligkeitsanspruches, vor eine Zerreißprobe.
Bot das Wormser Edikt von 1521, in dem die Reichsacht über Martin Luther verhängt wurde, noch keinerlei Spielräume für eine reformationsfreundliche Politik, auch wenn es nicht im ganzen Reich beachtet wurde, so wichen schon die Entscheidungen der nächsten Reichstage davon ab. Die meist ungenauen und zweideutigen Kompromissformeln der Reichstage waren Anlass für neuen juristischen Streit. So erklärte beispielsweise der Nürnberger Reichstag von 1524, alle sollten das Wormser Edikt, „so vil inen muglich” sei, befolgen. Eine endgültige Friedenslösung konnte allerdings nicht gefunden werden, man hangelte sich von einem meist zeitlich befristeten Kompromiss zum nächsten.
Befriedigend war diese Situation für keine der beiden Seiten. Die evangelische Seite besaß keine Rechtssicherheit und lebte mehrere Jahrzehnte in der Angst vor einem Religionskrieg. Die katholische Seite, insbesondere Kaiser Karl V., wollte eine dauerhafte Glaubensspaltung des Reiches nicht hinnehmen. Karl V., der anfangs den Fall Luther nicht richtig ernst nahm und seine Tragweite nicht erkannte, wollte diese Situation nicht akzeptieren, da er sich, wie die mittelalterlichen Herrscher, als Wahrer der einen wahren Kirche ansah. Das universale Kaisertum brauchte die universale Kirche.
Nach langem Zögern verhängte Karl im Sommer 1546 über die Anführer des evangelischen Schmalkaldischen Bundes die Reichsacht und leitete die militärische Reichsexekution ein. Diese Auseinandersetzung ging als Schmalkaldischer Krieg von 1547/48 in die Geschichte ein. Nach dem Sieg des Kaisers mussten die protestantischen Fürsten auf dem Geharnischten Augsburger Reichstag von 1548 das so genannte Augsburger Interim annehmen, das ihnen immerhin den Laienkelch und die Priesterehe zugestand. Dieser für die protestantischen Reichsstände recht glimpfliche Ausgang des Krieges war dem Umstand geschuldet, dass Karl neben religionspolitischen Zielen auch verfassungspolitische verfolgte, die zu einem Aushebeln der ständischen Verfassung und einer Quasi-Zentralregierung des Kaisers geführt hätten. Diese zusätzlichen Ziele brachten ihm den Widerstand der katholischen Reichsstände ein, so dass keine für ihn befriedigende Lösung der Religionsfrage möglich wurde.
Die religiösen Auseinandersetzungen im Reich waren in die Konzeption Karls V. eines umfassenden habsburgischen Reiches eingebunden, einer „monarchia universalis”, die Spanien, die österreichischen Erblande und das Heilige Römische Reich umfassen sollte. Es gelang ihm aber weder, das Kaisertum erblich zu machen, noch die Kaiserkrone zwischen der österreichischen und spanischen Linie der Habsburger hin- und herwechseln zu lassen.
Der Fürstenkrieg des sächsischen Kurfürsten Moritz von Sachsen gegen Karl V. und der daraus resultierende Passauer Vertrag von 1552 zwischen den Kriegsfürsten und dem späteren Kaiser Ferdinand I. waren erste Schritte hin zu einem dauerhaften Religionsfrieden im Reich, was 1555 zum Augsburger Reichs- und Religionsfrieden führte.
Der Frieden von Augsburg war aber nicht nur als Religionsfrieden bedeutsam, er besaß auch eine bedeutsame verfassungspolitische Rolle, indem durch die Schaffung der Reichsexekutionsordnung wichtige verfassungspolitische Weichenstellungen getroffen wurden. Diese Schritte waren durch den im fränkischen Raum von 1552 bis 1554 tobenden Zweiten Markgrafenkrieg des Kulmbacher Markgrafen Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach notwendig geworden. Albrecht erpresste Geld und sogar Gebiete von verschiedenen fränkischen Reichsgebieten. Kaiser Karl V. verurteilte dies nicht, er nahm Albrecht sogar in seine Dienste und legitimierte damit den Bruch des Ewigen Landfriedens. Da sich die betroffenen Territorien weigerten, den vom Kaiser bestätigten Raub ihrer Gebiete hinzunehmen, verwüstete Albrecht deren Land. Im nördlichen Reich formierten sich derweilen Truppen unter Moritz von Sachsen, um Albrecht zu bekämpfen. Ein Reichsfürst und später König Ferdinand, nicht der Kaiser hatten militärische Gegenmaßnahmen gegen den Friedensbrecher eingeleitet. Am 9. Juli 1553 kam es zur blutigsten Schlacht der Reformationszeit im Reich, der Schlacht bei Sievershausen, bei der Albrecht starb.
Die auf dem Reichstag zu Augsburg 1555 beschlossene Reichsexekutionsordnung beinhaltete die verfassungsmäßige Schwächung der kaiserlichen Gewalt, die Verankerung des reichsständischen Prinzips und die volle Föderalisierung des Reiches. Die Reichskreise und lokalen Reichsstände erhielten neben ihren bisherigen Aufgaben auch die Zuständigkeit für die Durchsetzung der Urteile und die Besetzung der Beisitzer des Reichskammergerichtes. Außerdem erhielten sie neben dem Münzwesen weitere wichtige, bisher kaiserliche Aufgaben. Da sich der Kaiser als unfähig und zu schwach erwiesen hatte, eine seiner wichtigsten Aufgaben, die Friedenswahrung, wahrzunehmen, wurde dessen Rolle nunmehr durch die in den Reichskreisen verbundenen Reichsstände ausgefüllt.
Ebenso wichtig wie die Exekutionsordnung war der am 25. September 1555 verkündete Religionsfrieden, mit dem die Idee eines konfessionell einheitlichen Reiches aufgegeben wurde. Die Landesherren erhielten das Recht, die Konfession ihrer Untertanen zu bestimmen, prägnant zusammengefasst in der Formel „wessen Herrschaft, dessen Religion”. In protestantischen Gebieten ging die geistliche Gerichtsbarkeit auf die Landesherren über, wodurch diese zu einer Art geistlichen Oberhauptes ihres Territoriums wurden. Weiterhin wurde festgelegt, dass geistliche Reichsstände, also Erzbischöfe, Bischöfe und Reichsprälaten, katholisch bleiben mussten. Diese und einige weitere Festlegungen führten zwar zu einer friedlichen Lösung des Religionsproblems, manifestierten aber auch die zunehmende Spaltung des Reiches und führten mittelfristig zu einer Blockade der Reichsinstitutionen.
Nach dem Reichstag von Augsburg trat Kaiser Karl V. von seinem Amt zurück und übergab die Macht an seinen Bruder, den römisch-deutschen König Ferdinand I. Karls Politik innerhalb und außerhalb des Reiches war endgültig gescheitert. Ferdinand beschränkte die Herrschaft des Kaisers wieder auf Deutschland, und es gelang ihm, die Reichsstände wieder in eine engere Verbindung mit dem Kaisertum zu bringen und dieses damit wieder zu stärken. Deshalb wird Ferdinand vielfach als der Gründer des neuzeitlichen deutschen Kaisertums bezeichnet.
Konfessionalisierung und Dreißigjähriger Krieg
Bis Anfang der 1580er Jahre gab es im Reich eine Phase ohne größere kriegerische Auseinandersetzungen. Der Religionsfrieden wirkte befriedend und auch die Reichsinstitutionen wie Reichskreise und Reichskammergericht entwickelten sich zu wirksamen und anerkannten Instrumenten der Friedenssicherung. In dieser Zeit vollzog sich aber die sogenannte Konfessionalisierung, das heißt die Verfestigung und Abgrenzung der drei Konfessionen Protestantismus, Kalvinismus und Katholizismus zueinander. Die damit einhergehende Herausbildung frühmoderner Staatsformen in den Territorien brachte dem Reich Verfassungsprobleme. Die Spannungen nahmen derart zu, dass das Reich und seine Institutionen ihre über den Konfessionen stehende Schlichterfunktion nicht mehr wahrnehmen konnten und Ende des 16. Jahrhunderts faktisch blockiert waren. Bereits ab 1588 war das Reichskammergericht nicht mehr handlungsfähig.
Da die protestantischen Stände am Beginn des 17. Jahrhunderts auch den ausschließlich durch den katholischen Kaiser besetzten Reichshofrat nicht mehr anerkannten, eskalierte die Situation weiter. Gleichzeitig spalteten sich das Kurfürstenkolleg und die Reichskreise in konfessionelle Gruppierungen. Ein Reichsdeputationstag im Jahr 1601 scheiterte an den Gegensätzen zwischen den Parteien und 1608 wurde ein Reichstag in Regensburg ohne Reichsabschied beendet, da die kalvinistische Kurpfalz, deren Bekenntnis vom Kaiser nicht anerkannt wurde, und andere protestantische Stände diesen verlassen hatten.
Da das Reichssystem weitestgehend blockiert und der Friedensschutz vermeintlich nicht mehr gegeben war, gründeten sechs protestantische Fürsten am 14. Mai 1608 die Protestantische Union. Weitere Fürsten und Reichsstädte schlossen sich später der Union an, der jedoch Kursachsen und die norddeutschen Fürsten fernblieben. Als Reaktion auf die Union gründeten katholische Fürsten und Städte am 10. Juli 1609 die katholische Liga. Die Liga wollte das bisherige Reichssystem aufrechterhalten und das Übergewicht des Katholizismus im Reich bewahren. Das Reich und seine Institutionen waren damit endgültig blockiert und handlungsunfähig geworden.
Der Prager Fenstersturz war dann der Auslöser für den großen Krieg, in dem der Kaiser anfangs große militärische Erfolge erzielte und auch versuchte diese reichspolitisch für seine Machtstellung gegenüber den Reichsständen auszunutzen. So ächtete Kaiser Ferdinand II. im Jahre 1621 aus eigenem Machtanspruch den pfälzischen Kurfürsten und böhmischen König Friedrich V. und übertrug die Kurwürde auf Maximilian I. von Bayern. Ferdinand war zuvor von allen, auch den protestantischen, Kurfürsten am 19. August 1619 trotz des beginnenden Krieges zum Kaiser gewählt worden.
Der Erlass des Restitutionsediktes am 6. März 1629 war der letzte bedeutende Gesetzesakt eines Kaisers im Reich und entsprang genauso wie die Ächtung Friedrichs V. dem kaiserlichen Machtanspruch.

Fenstersturz zu Prag 1618
(Illustration aus Theatrum Europaeum, Bd. 1)
Datierung: zwischen 1633 und 1738
Dieses Edikt verlangte die Umsetzung des Augsburger Reichsfriedens nach katholischer Interpretation. Dementsprechend waren alle seit dem Passauer Vertrag durch die protestantischen Landesherren säkularisierten Erz- und Hochstifte und Bistümer an die Katholiken zurückzugeben. Dies hätte neben der Rekatholisierung großer protestantischer Gebiete eine wesentliche Stärkung der kaiserlichen Machtposition bedeutet, da bisher religionspolitische Fragen vom Kaiser gemeinsam mit den Reichsständen und Kurfürsten entschieden worden waren. Dagegen bildete sich eine konfessionsübergreifende Koalition der Kurfürsten. Sie wollten nicht hinnehmen, dass der Kaiser ohne ihre Zustimmung solch ein einschneidendes Edikt erließ.
Die Kurfürsten zwangen den Kaiser auf dem Kurfürstentag 1630 unter der Führung des neuen katholischen Kurfürsten Maximilian I. den kaiserlichen Generalissimus Wallenstein zu entlassen und einer Überprüfung des Ediktes zuzustimmen. Ebenfalls im Jahre 1630 trat Schweden auf Seiten der protestantischen Reichsstände in den Krieg ein. Nachdem die kaiserlichen Truppen Schweden einige Jahre unterlegen gewesen waren, gelang es dem Kaiser durch den Sieg in der Schlacht bei Nördlingen im Jahre 1634 nochmals die Oberhand zu gewinnen. Im darauffolgenden Prager Frieden zwischen dem Kaiser und Kursachsen von 1635 musste Ferdinand zwar das Restitutionsedikt für vierzig Jahre, vom Stand des Jahres 1627 ausgehend, aussetzen. Aber das Reichsoberhaupt ging aus diesem Frieden gestärkt hervor, da bis auf den Kurverein alle reichsständischen Allianzen für aufgelöst erklärt wurden und dem Kaiser der Oberbefehl über die Reichsarmee zugebilligt wurde. Diese Stärkung des Kaisers nahmen aber auch die Protestanten hin. Das religionspolitische Problem des Restitutionsediktes war faktisch um 40 Jahre vertagt worden, da sich der Kaiser und die meisten Reichsstände darin einig waren, dass die politische Einigung des Reiches, die Säuberung des Reichsgebietes von fremden Mächten und die Beendigung des Krieges am vordringlichsten seien.
Nach dem offenen Kriegseintritt Frankreichs, der erfolgte, um eine starke kaiserlich-habsburgische Macht in Deutschland zu verhindern, verschoben sich die Gewichte wieder zu Ungunsten des Kaisers. Spätestens hier war aus dem ursprünglichen teutschen Konfessionskrieg innerhalb des Reiches ein europäischer Hegemonialkampf geworden. Der Krieg ging also weiter, da die konfessions- und verfassungspolitischen Probleme, die zumindest provisorisch im Prager Frieden geklärt worden waren, für die sich auf Reichsgebiet befindlichen Mächte Schweden und Frankreich nebenrangig waren. Außerdem wies der Frieden von Prag wie bereits angedeutet schwere Mängel auf, so dass auch die reichsinternen Auseinandersetzungen weitergingen.
Ab 1641 begannen einzelne Reichsstände Separatfrieden zu schließen, da sich in dem Gestrüpp aus konfessioneller Solidarität, traditioneller Bündnispolitik und aktueller Kriegslage kaum mehr eine breit angelegte Gegenwehr des Reiches organisieren ließ. Den Anfang machte im Mai 1641 als erster größerer Reichsstand der Kurfürst von Brandenburg. Dieser schloss Frieden mit Schweden und entließ seine Armee, was nach den Bestimmungen des Prager Friedens eigentlich nicht möglich war, da diese nominell zur Reichsarmee gehörte. Andere Reichsstände folgten; so schloss 1645 Kursachsen Frieden mit Schweden und 1647 Kurmainz mit Frankreich.
Gegen den Willen des Kaisers, seit dem Jahre 1637 Ferdinand III., der ursprünglich das Reich bei den sich nun anbahnenden Friedensgesprächen in Münster und Osnabrück entsprechend dem Frieden von Prag allein vertreten wollte, wurden die Reichsstände, die von Frankreich unterstützt auf ihre Libertät pochten, zu den Unterredungen zugelassen. Dieser als Admissionsfrage bezeichnete Streit hebelte das System des Prager Friedens mit der starken Stellung des Kaisers endgültig aus. Ferdinand wollte ursprünglich in den westfälischen Verhandlungen nur die europäischen Fragen klären und Frieden mit Frankreich und Schweden schließen und die deutschen Verfassungsprobleme auf einem anschließenden Reichstag behandeln, auf dem er als glorioser Friedensbringer hätte auftreten können. Auf diesem Reichstag wiederum hätten die fremden Mächte nichts zu suchen gehabt.
Westfälischer Frieden
Der Kaiser, Schweden und Frankreich verständigten sich 1641 in Hamburg auf Friedensverhandlungen, währenddessen die Kampfhandlungen weitergingen. Die Verhandlungen begannen 1642/43 parallel in Osnabrück zwischen dem Kaiser, den evangelischen Reichsständen und Schweden und in Münster zwischen dem Kaiser, den katholischen Reichsständen und Frankreich. Dass der Kaiser das Reich nicht allein repräsentierte, war eine symbolisch wichtige Niederlage. Die aus dem Frieden von Prag gestärkt hervorgegangene kaiserliche Macht stand wieder zur Disposition. Die Reichsstände gleich welcher Konfession hielten die Prager Ordnung für so gefährlich, dass sie ihre Rechte besser gewahrt sahen, wenn sie nicht allein dem Kaiser gegenüber saßen, sondern die Verhandlungen über die Reichsverfassung unter den Augen des Auslands stattfanden. Dies kam aber auch Frankreich sehr entgegen, das die Macht der Habsburger unbedingt einschränken wollte und sich deshalb für die Beteiligung der Reichsstände stark machte.
Beide Verhandlungsstädte und die Verbindungswege zwischen ihnen waren vorab für entmilitarisiert erklärt worden (was aber nur für Osnabrück vollzogen wurde) und alle Gesandtschaften erhielten freies Geleit. Zur Vermittlung reisten Delegationen der Republik Venedig, des Papstes und aus Dänemark an und Vertreter weiterer europäischer Mächte strömten nach Westfalen. Am Ende waren alle europäischen Mächte, bis auf das Osmanische Reich, Russland und England, an den Verhandlungen beteiligt. Die Verhandlungen in Osnabrück wurden neben den Verhandlungen zwischen dem Reich und Schweden faktisch zu einem Verfassungskonvent, auf dem die verfassungs- und religionspolitischen Probleme behandelt wurden.

Unterzeichnung des Westfälischen Friedens 1648 in Münster, Deutschland
von Gerard Terborch (1617 - 1681):
Die spanischen und niederländischen Gesandten beschwören am 15. Mai 1648 im Rathaussaal zu Münster den Frieden von Münster.
In Münster verhandelte man über die europäischen Rahmenbedingungen und die lehnsrechtlichen Veränderungen in Bezug auf die Niederlande und die Schweiz. Weiterhin wurde hier der Friede von Münster zwischen Spanien und der Republik der Niederlande ausgehandelt.
Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts wurde der Westfälische Frieden als zerstörerisch für das Reich angesehen. Hartung begründete dies mit dem Argument, der Friedensschluss habe dem Kaiser jegliche Handhabe und den Reichsständen fast unbegrenzte Handlungsfreiheit gewährt, das Reich sei durch diesen „zersplittert”, „zerbröckelt” – es handle sich mithin um ein „nationales Unglück”. Nur die religionspolitische Frage sei gelöst worden, das Reich aber in eine Erstarrung verfallen, die letztendlich zu dessen Zerfall geführt habe.
In der Zeit direkt nach dem Westfälischen Frieden und auch noch während des 18. Jahrhunderts wurde der Friedensschluss hingegen ganz anders gesehen. Er wurde mit großer Freude begrüßt und galt als neues Grundgesetz, das überall da gelte, wo der Kaiser mit seinen Vorrechten und als Symbol der Einheit des Reiches anerkannt werde. Der Frieden stellte durch seine Bestimmungen die Territorialherrschaften und die verschiedenen Konfessionen auf eine einheitliche rechtliche Basis und schrieb die nach der Verfassungskrise Anfang des 16. Jahrhunderts geschaffenen und bewährten Mechanismen fest und verwarf diejenigen des Prager Friedens. Georg Schmidt schreibt zusammenfassend:
Der Frieden hat weder die staatliche Zersplitterung noch den fürstlichen Absolutismus hervorgebracht. [...] Der Friede betonte die ständische Freiheit, machte aus den Ständen aber keine souveränen Staaten.
Allen Reichsständen wurden zwar die vollen landeshoheitlichen Rechte zugesprochen und das im Prager Frieden annullierte Bündnisrecht wieder zuerkannt. Damit war aber nicht die volle Souveränität der Territorien gemeint, was sich auch daran erkennen lässt, dass dieses Recht im Vertragstext inmitten anderer schon länger ausgeübter Rechte aufgeführt wird. Das Bündnisrecht – auch dies widerspricht einer vollen Souveränität der Territorien des Reiches – durfte sich nicht gegen Kaiser und Reich, den Landfrieden oder gegen diesen Vertrag richten und war nach Meinung zeitgenössischer Rechtsgelehrter sowieso ein althergebrachtes Gewohnheitsrecht der Reichsstände, das im Vertrag nur schriftlich fixiert wurde.
Im religionspolitischen Teil entzogen sich die Reichsstände praktisch selbst die Befugnis die Konfession ihrer Untertanen zu bestimmen. Zwar wurde der Augsburger Religionsfrieden als Ganzes bestätigt und für unantastbar erklärt, die strittigen Fragen wurden aber neu geregelt und Rechtsverhältnisse auf den Stand des 1. Januar 1624 fixiert beziehungsweise auf den Stand an diesem Stichtag zurückgesetzt. Alle Reichsstände mussten so beispielsweise die beiden anderen Konfessionen dulden, falls diese bereits 1624 auf ihrem Territorium existierten. Jeglicher Besitz musste an den damaligen Besitzer zurückgegeben werden und alle späteren anderslautenden Bestimmungen des Kaisers, der Reichsstände oder der Besatzungsmächte wurden für null und nichtig erklärt.
Der zweite Religionsfrieden hat sicherlich keinerlei Fortschritte für den Toleranzgedanken oder für die individuellen Religionsrechte oder sogar die Menschenrechte gebracht. Das war aber auch nicht dessen Ziel. Er sollte durch die weitere Verrechtlichung friedensstiftend wirken. Frieden und nicht Toleranz oder Säkularisierung war das Ziel. Dass dies trotz aller Rückschläge und gelegentlicher Todesopfer bei späteren religiösen Auseinandersetzungen gelang, ist offensichtlich.
Die Verträge von Westfalen haben dem Reich nach dreißig Jahren den langersehnten Frieden gebracht. Das Reich verlor einige Gebiete an Frankreich und entließ faktisch die Niederlande und die Eidgenossenschaft aus dem Reichsverband. Ansonsten änderte sich im Reich nicht viel, das Machtsystem zwischen Kaiser und Reichsständen wurde neu austariert ohne die Gewichte im Vergleich zur Situation vor dem Krieg stark zu verschieben und die Reichspolitik wurde nicht entkonfessionalisiert, sondern nur der Umgang der Konfessionen neu geregelt. Weder wurde
[der] Reichsverband zur Erstarrung verdammt noch gesprengt – das sind lange Zeit inbrünstig gehegte Forschungsmythen. Nüchtern betrachtet, verliert der Westfälische Frieden, dieses angebliche nationale Unglück, viel von seinem Schrecken, aber auch viel von seinem vermeintlich epochalen Charakter. Dass er Reichsidee und Kaisertum zerstört habe, das ist das krasseste aller kursierenden Fehlurteile über den Westfälischen Frieden
Die Ergebnisse der Friedensverhandlungen zeigen, wie sinnlos dieser Krieg war. Cicely Veronica Wedgwood:
Nachdem so viele Menschenleben für einen so geringen Zweck vergeudet worden waren, hätten die Menschen begreifen müssen, wie durchaus vergeblich es ist, Glaubensmeinungen dem Urteil durch das Schwert zu überlassen. [...]
Der Krieg löste keine Schwierigkeit. Seine unmittelbaren und mittelbaren Wirkungen waren entweder negativ oder verheerend. Sittlich umstürzlerisch, wirtschaftlich zerstörend, sozial herabsetzend, verworren in seinen Ursachen, schwankend in seinem Verlauf und geringfügig in seinem Erfolg, ist dieser Krieg in der europäischen Geschichte das hervorragende Beispiel eines sinnlosen Konflikts.
Das Reich bis Mitte des 18. Jahrhunderts

Darstellung des Immerwährenden Reichstages im Reichssaal des Regensburger Rathauses, Kupferstich 1663
Nach dem Westfälischen Frieden drängte eine Gruppe von Fürsten, zusammengeschlossen im Fürstenverein, auf radikale Reformen im Reich, die insbesondere die Vorherrschaft der Kurfürsten beschränken und das Königswahlprivileg auch auf andere Reichsfürsten ausdehnen sollten. Auf dem Reichstag von 1653/54, der nach den Bestimmungen des Friedens eigentlich viel früher hätte stattfinden sollen, konnte sich diese Minderheit aber nicht durchsetzen. Im Reichsabschied dieses Reichstages, genannt der Jüngste – dieser Reichstag war der letzte vor der Permanenz des Gremiums – wurde beschlossen, dass die Untertanen ihren Herren Steuern zahlen müssten, damit diese Truppen unterhalten könnten. Dies führte oft zur Bildung stehender Heere in verschiedenen größeren Territorien. Diese wurden als Armierte Reichsstände bezeichnet.
Auch zerfiel das Reich nicht, da zu viele Stände ein Interesse an einem Reich hatten, das ihren Schutz gewährleisten konnte. Diese Gruppe umfasste besonders die kleineren Stände, die praktisch nie zu einem eigenen Staat werden konnten. Auch die aggressive Politik Frankreichs an der Westgrenze des Reiches und die Türkengefahr im Osten machten nahezu allen Ständen die Notwendigkeit eines hinlänglich geschlossenen Reichsverbandes und einer handlungsfähigen Reichsspitze deutlich.
Seit 1658 herrschte Kaiser Leopold I., dessen Wirken erst seit den 1990er Jahren genauer untersucht wird, im Reich. Sein Wirken wird als klug und weitsichtig beschrieben und gemessen an der Ausgangslage nach dem Krieg und dem Tiefpunkt des kaiserlichen Ansehens war es auch außerordentlich erfolgreich. Leopold gelang es durch die Kombination verschiedener Herrschaftsinstrumente die kleineren und – und das ist das Bemerkenswerte – die größeren Reichsstände wieder an die Reichsverfassung und an das Kaisertum zu binden. Hervorzuheben sind hier insbesondere seine Heiratspolitik, das Mittel der Standeserhöhungen und die Verleihung allerlei wohlklingender Titel. Am wichtigsten für das Reich dürften die Verleihung der achten Kurwürde an Ernst August von Hannover 1692 und das Zugeständnis an den brandenburgischen Kurfürsten, für das nicht zum Reich gehörende Preußen seit 1701 den Titel „König in Preußen” führen zu dürfen, gewesen sein.
Nach 1648 wurde die Position der Reichskreise weiter gestärkt und ihnen eine entscheidende Rolle in der Reichskriegsverfassung zugesprochen. So beschloss der Reichstag 1681 auf Grund der Bedrohung des Reiches durch die Türken eine neue Reichskriegsverfassung, in der die Truppenstärke der Reichsarmee auf 40.000 Mann festgelegt wurde. Für die Aufstellung der Truppen sollten die Reichskreise zuständig sein. Der Immerwährende Reichstag bot dem Kaiser die Möglichkeit die kleineren Reichsstände an sich zu binden und für die eigene Politik zu gewinnen. Auch durch die verbesserten Möglichkeiten der Schlichtung gelang es dem Kaiser seinen Einfluss auf das Reich wieder zu vergrößern.
Dass sich Leopold I. der Reunionspolitik des französischen Königs Ludwigs XIV. entgegenstemmte und versuchte die Reichskreise und -stände zum Widerstand gegen die französischen Annexionen von Reichsgebieten zu bewegen, zeigt, dass die Reichspolitik noch nicht wie unter seinen Nachfolgern im 18. Jahrhundert zum reinen Anhängsel der habsburgischen Großmachtpolitik geworden war.
Der Dualismus zwischen Preußen und Österreich
Ab 1740 begannen die beiden größten Territorialkomplexe des Reiches, die habsburgischen Erblande und Brandenburg-Preußen, immer mehr aus dem Reichsverband herauszuwachsen. Österreich konnte nach dem Sieg über die Türken große Gebiete außerhalb des Reiches erwerben, wodurch sich automatisch der Schwerpunkt der habsburgischen Politik nach Südosten verschob. Dies wurde besonders unter den Nachfolgern Leopolds I. deutlich. Ähnlich verhielt es sich mit Brandenburg-Preußen, auch hier lag ein Großteil des Territoriums außerhalb des Reiches. Zur zunehmenden Rivalität, die das Reichsgefüge stark beanspruchte, traten jedoch noch Änderungen im Denken der Zeit hinzu.
War es bis zum Dreißigjährigen Krieg für das Ansehen eines Herrschers sehr wichtig, welche Titel er besaß und an welcher Position in der Hierarchie des Reiches und des europäischen Adels er stand, so traten nun andere Faktoren wie die Größe des Territoriums sowie die wirtschaftliche und militärische Macht stärker in den Vordergrund. Es setzte sich die Ansicht durch, dass nur die Macht, die aus diesen quantifizierbaren Angaben resultierte, tatsächlich zähle. Dies ist nach Ansicht von Historikern eine Spätfolge des großen Krieges, in dem altehrwürdige Titel, Ansprüche und Rechtspositionen insbesondere der kleineren Reichsstände fast keine Rolle mehr spielten und fingierten oder tatsächlichen Sachzwängen des Krieges untergeordnet wurden.
Diese Denkkategorien waren jedoch nicht mit dem bisherigen System des Reiches vereinbar, das dem Reich und allen seinen Mitgliedern einen rechtlichen Schutz des Status quo gewährleisten und sie vor dem Übermut der Macht schützen sollte. Dieser Konflikt zeigt sich unter anderem in der Arbeit des Reichstages. Seine Zusammensetzung unterschied zwar zwischen Kurfürsten und Fürsten, Hocharistokratie und städtischen Magistraten, katholisch und protestantisch, aber beispielsweise nicht zwischen Ständen, die ein stehendes Heer unterhielten, und denen, die schutzlos waren. Diese Diskrepanz zwischen tatsächlicher Macht und althergebrachter Hierarchie führte zum Verlangen der großen, mächtigen Stände nach einer Lockerung des Reichsverbandes.
Hinzu kam das Denken der Aufklärung, das den konservativen bewahrenden Charakter, die Komplexität, ja sogar die Idee des Reiches an sich hinterfragte und als „unnatürlich” darstellte. Die Idee der Gleichheit der Menschen war nicht in Übereinstimmung zu bringen mit der Reichsidee, das Vorhandene zu bewahren und jedem Stand seinen zugewiesenen Platz im Gefüge des Reiches zu sichern.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Brandenburg-Preußen und Österreich nicht mehr in den Reichsverband passten, nicht nur auf Grund der schieren Größe, sondern auch wegen der inneren Verfasstheit der beiden zu Staaten gewordenen Territorien. Beide hatten die ursprünglich auch in ihrem Inneren dezentral und ständisch geprägten Länder reformiert und den Einfluss der Landstände gebrochen. Nur so waren die verschiedenen ererbten und eroberten jeweiligen Länder sinnvoll zu verwalten und zu bewahren sowie ein stehendes Heer zu finanzieren. Den kleineren Territorien war dieser Reformweg verschlossen. Ein Landesherr, der Reformen dieses Ausmaßes unternommen hätte, wäre unweigerlich mit den Reichsgerichten in Konflikt geraten, da diese den Landständen beigestanden hätten, gegen deren Privilegien ein Landesherr hätte verstoßen müssen. Der Kaiser in seiner Rolle als österreichischer Landesherr hatte den von ihm besetzten Reichshofrat natürlich nicht so zu fürchten wie andere Landesherrn und in Berlin scherte man sich um die Reichsinstitutionen sowieso kaum. Eine Exekution der Urteile wäre faktisch nicht möglich gewesen. Auch diese andere innere Verfasstheit der beiden großen Mächte trug zur Entfremdung vom Reich bei.
Aus der als „Dualismus zwischen Preußen und Österreich” bezeichneten Rivalität erwuchsen im 18. Jahrhundert mehrere Kriege. Die zwei Schlesischen Kriege gewann Preußen und erhielt Schlesien, während der Österreichische Erbfolgekrieg zu Gunsten Österreichs endete. Während des Erbfolgekrieges kam mit Karl VII. ein Wittelsbacher auf den Thron, konnte sich aber ohne die Ressourcen einer Großmacht nicht durchsetzen, so dass nach seinem Tod 1745 mit Franz I. Stephan von Lothringen, dem Ehemann Maria Theresias, wieder ein Habsburger(-Lothringer) gewählt wurde.
Diese Auseinandersetzungen waren für das Reich verheerend. Preußen wollte das Reich nicht stärken, sondern für seine Zwecke gebrauchen. Die Habsburger, durch das Bündnis vieler Reichsstände mit Preußen und die Wahl eines Nicht-Habsburgers auf den Kaiserthron verstimmt, setzten nun viel eindeutiger als bislang auf eine Politik, die sich allein auf Österreich und dessen Macht bezog. Der Kaisertitel wurde fast nur noch wegen dessen Klang und des höheren Rangs gegenüber allen europäischen Herrschern erstrebt. Die Reichsinstitutionen waren zu Nebenschauplätzen der Machtpolitik verkommen und die Verfassung des Reiches hatte mit der Wirklichkeit nicht mehr viel zu tun. Preußen versuchte durch Instrumentalisierung des Reichstages den Kaiser und Österreich zu treffen. Insbesondere Kaiser Joseph II. zog sich fast gänzlich aus der Reichspolitik zurück. Joseph II. hatte anfangs noch versucht eine Reform der Reichsinstitutionen, besonders des Reichskammergerichtes, durchzuführen, scheiterte aber am Widerstand der Reichsstände, die sich aus dem Reichsverband lösen und sich deshalb vom Gericht nicht mehr in ihre „inneren” Angelegenheiten hereinreden lassen wollten. Joseph gab frustriert auf.
Aber auch sonst agierte Joseph II. unglücklich und unsensibel. Die österreichzentrierte Politik Josephs II. während des Bayerischen Erbfolgekriegs 1778/79 und die vom Ausland vermittelte Friedenslösung von Teschen waren ein Desaster für das Kaisertum. Als die bayerische Linie der Wittelsbacher im Jahre 1777 ausstarb, erschien dies Joseph als willkommene Möglichkeit, Bayern den habsburgischen Landen einzuverleiben. Deshalb erhob Österreich juristisch fragwürdige Ansprüche auf das Erbe. Unter massivem Druck aus Wien willigte der Erbe aus der pfälzischen Linie der Wittelsbacher, Kurfürst Karl Theodor, in einen Vertrag ein, der Teile Bayerns abtrat. Karl Theodor, der ohnehin nur widerwillig das Erbe angenommen hatte, wurde suggeriert, dass später ein Tausch mit den Österreichischen Niederlanden, die in etwa das Gebiet des heutigen Belgiens umfassten, zu Stande käme. Joseph II. besetzte aber stattdessen die bayerischen Gebiete, um vollendete Tatsachen zu schaffen, und vergriff sich somit als Kaiser an einem Reichsterritorium.
Diese Vorgänge erlaubten es Friedrich II., sich zum Beschützer des Reiches und der kleinen Reichsstände und damit quasi zum „Gegenkaiser” aufzuschwingen. Preußische und kursächsische Truppen marschierten in Böhmen ein. Im von Russland regelrecht erzwungenen Frieden von Teschen vom 13. Mai 1779 erhielt Österreich zwar das Innviertel zugesprochen. Der Kaiser stand dennoch als Verlierer da. Zum zweiten Mal nach 1648 musste ein innerdeutsches Problem mit Hilfe ausländischer Mächte geregelt werden. Nicht der Kaiser, sondern Russland brachte dem Reich Frieden. Russland wurde neben seiner Rolle als Garantiemacht des Teschener Friedens auch eine Garantiemacht des Westfälischen Friedens und damit einer der „Hüter“ der Reichsverfassung. Das Kaisertum hatte sich selbst demontiert und der preußische König Friedrich stand als Beschützer des Reiches da. Aber nicht Schutz und Konsolidierung des Reiches waren Friedrichs Ziel gewesen, sondern eine weitere Schwächung der Position des Kaisers im Reich und damit des ganzen Reichsverbandes an sich. Dieses Ziel hatte er erreicht.
Das Konzept eines „Dritten Deutschlands” hingegen, geboren aus der Befürchtung der kleineren und mittleren Reichsstände zur reinen Verfügungsmasse der Großen zu verkommen, um mit einer Stimme zu sprechen und damit Reformen durchzusetzen, scheiterte am ewigen Widerspruch zwischen dem protestantischen Norden und dem katholischen Süden, dem Widerstand der Kurfürsten und der großen Reichsstände. All dies führte letztendlich auch zu einer Reichsmüdigkeit bei den kleinen, mittleren und geistlichen Ständen, die eigentlich seit jeher die Stütze des Reiches waren. Wenige Jahre später versetzte Napoléon dem Reich, das fast jegliche Widerstandskraft eingebüßt hatte, den Todesstoß.
Das Ende des Reiches
Koalitionskriege gegen Napoléon und Reichsdeputationshauptschluss
Gegen die revolutionären Truppen Frankreichs fanden beide deutschen Großmächte im Ersten Koalitionskrieg zu einem Zweckbündnis. Dieses als Pillnitzer Beistandspakt bezeichnete Bündnis vom Februar 1792 hatte freilich nicht den Schutz von Reichsrechten zum Ziel, sondern man erhoffte sich reiche Beute beziehungsweise gönnte dem anderen nicht einen eventuellen alleinigen Sieg. Die Chance die anderen Reichsstände hinter sich zu bringen verspielte Kaiser Franz II., der am 5. Juli 1792 in ungewohnter Eile und Einmütigkeit zum Kaiser gewählt wurde, durch den Umstand, dass er das österreichische Staatsgebiet unbedingt vergrößern wollte, notfalls auf Kosten anderer Reichsmitglieder. Und auch Preußen wollte sich für seine Kriegskosten durch die Einverleibung geistlicher Reichsgebiete schadlos halten. Dementsprechend gelang es nicht eine geschlossene Front gegen die französischen Revolutionstruppen aufzubauen und größere militärische Erfolge zu erringen.
Aus Enttäuschung über ausbleibende Erfolge und um sich besser um den Widerstand gegen die erneute Teilung Polens kümmern zu können, schloss Preußen 1795 einen Separatfrieden, den Frieden von Basel, mit Frankreich. 1796 schlossen Baden und Württemberg ebenfalls Frieden mit Frankreich. In beiden Vereinbarungen wurden die jeweiligen linksrheinischen Besitzungen an Frankreich abgetreten. Die Besitzer aber sollten auf Kosten rechtsrheinischer geistlicher Gebiete „entschädigt” werden, diese sollten also säkularisiert werden. Weitere Reichsstände verhandelten über einen Waffenstillstand oder Neutralität.
Im Jahre 1797 schloss auch Österreich Frieden und unterschrieb den Frieden von Campo Formio, in dem es verschiedene Besitzungen innerhalb und außerhalb des Reiches abtrat, so insbesondere die österreichischen Niederlande und das Herzogtum Toskana. Als Ausgleich sollte Österreich ebenfalls auf Kosten von zu säkularisierenden geistlichen Gebieten oder anderen Reichsteilen entschädigt werden. Beide Großen des Reiches hielten sich also an anderen kleineren Reichsgliedern schadlos und räumten Frankreich sogar ein Mitspracherecht bei der zukünftigen Gestaltung des Reiches ein. Insbesondere der Kaiser, zwar als König von Ungarn und Böhmen handelnd, aber nichtsdestotrotz als Kaiser zur Bewahrung der Integrität des Reiches und seiner Mitglieder verpflichtet, hatte zugelassen, dass für die „Entschädigung” einiger weniger andere Reichsstände geschädigt wurden, und das Kaisertum damit irreparabel demontiert.
Die Reichsdeputation von 1797/98 willigte im März 1798 gezwungenermaßen auf dem Friedenskongress von Rastatt in die Abtretung der linksrheinischen Gebiete und die Säkularisierungen, mit Ausnahme der drei geistlichen Kurfürstentümer, ein. Der Zweite Koalitionskrieg beendete aber das Geschachere und Gefeilsche um die Gebiete, die man zu erhalten hoffte. Der Krieg wurde 1801 durch den Friede von Lunéville beendet, in dem Franz II. nun auch als Reichsoberhaupt der Abtretung der linksrheinischen Gebiete zustimmte. In diesem Frieden traf man aber keine genauen Festlegungen für die anstehenden „Entschädigungen”. Der anschließend einberufene Reichstag stimmte dem Frieden zu.
Die Friedensvereinbarungen von Basel mit Preußen, Campo Formio mit Österreich und Lunéville mit dem Reich verlangten „Entschädigungen”, über die nur ein Reichsgesetz entscheiden konnte. Deshalb wurde eine Reichsdeputation einberufen, die diesen Entschädigungsplan ausarbeiten sollte. Letztendlich nahm die Deputation aber den französisch-russischen Entschädigungsplan vom 3. Juni 1802 mit geringen Änderungen an. Am 24. März 1803 akzeptierte der Reichstag den Reichsdeputationshauptschluss endgültig.
Als Entschädigungsmasse für die größeren Reichsstände wurden fast alle Reichsstädte, die kleineren weltlichen Territorien und fast alle geistlichen Hoch- und Erzstifte auserkoren. Die Zusammensetzung des Reiches veränderte sich schlagartig, die zuvor mehrheitlich katholische Fürstenbank des Reichstages war nunmehr protestantisch geprägt. Zwei von drei geistlichen Kurfürstentümern hatten aufgehört zu existieren, auch der Kurfürst von Mainz verlor sein Hochstift, erhielt aber als neues Kurfürstentum Aschaffenburg-Regensburg. Neben diesem gab es nur noch zwei geistliche Reichsfürsten, den Großprior des Malteserordens und den Hoch- und Deutschmeister des Deutschen Ordens. Insgesamt kostete der Reichsdeputationshauptschluss 110 Territorien die Existenz und rund drei Millionen Menschen wurden einer neuen Obrigkeit unterstellt.
Diese territoriale Neuordnung des Reiches beeinflusste die politische Landschaft Mitteleuropas weit über die drei Jahre seiner Gültigkeit hinaus. Er führte nach dem Normaljahr 1624 des Westfälischen Friedens ein neues Normaljahr, das Jahr 1803, für die konfessionellen und vermögensrechtlichen Verhältnisse in Deutschland ein und schuf aus einer Vielzahl kleiner und kleinster Gebiete eine überschaubare Anzahl von Mittelstaaten.
Offiziell wurde zum Zwecke der „Entschädigung” „säkularisiert” und „mediatisiert”. Dies kann man getrost als Euphemismus für diesen Vorgang bezeichnen, da einige wenige viel mehr erhielten als sie tatsächlich verloren hatten. Der badische Markgraf erhielt beispielsweise mehr als neunmal soviele Untertanen, wie er linksrheinisch abtreten musste. Grund hierfür ist, dass Frankreich sich eine Reihe von Satellitenstaaten schuf, die groß genug waren, um dem Kaiser Schwierigkeiten zu machen, aber zu klein, um die Position Frankreichs zu gefährden.
Weiterhin hatte die Reichskirche aufgehört zu existieren, diese Besonderheit des Reiches, der Teil der Reichsfürsten, der das Reich eigentlich zu dem machte, was es war. Sie war so fest verankert im System des Reiches, dass sie sogar schon vor dem Ende des Reiches unterging. Die antiklerikalen Positionen Frankreichs hatten ihr Übriges getan, zumal man damit den Kaiser einer seiner wichtigsten Machtpositionen berauben konnte. Aber auch der aufklärerische Zeitgeist und der absolutistische Allzuständigkeitswahn trugen dazu bei, dass die Reichskirche obsolet geworden war und selbst katholische Reichsfürsten Begehrlichkeiten entwickelten. Die katholischen Fürsten wurmte sowieso schon länger, dass die protestantischen Fürsten ihre jeweiligen Kirchen als Machtmittel gebrauchten.
Dass im Herbst 1803 auch die Reichsritterschaften im sogenannten Rittersturm von den umschließenden oder angrenzenden Territorien okkupiert wurden, zeigt, wie viel die Gesetze des Reiches noch galten.
Niederlegung der Reichskrone
Am 18. Mai 1804 ernannte sich Napoleon zum erblichen Kaiser der Franzosen. Mit dieser Erhöhung wollte er einerseits seine Macht festigen, andererseits seine Größe noch deutlicher sichtbar machen. Vor allem wollte er das Erbe Karls des Großen antreten und somit seinem erblichen Kaisertum eine in der Tradition des Mittelalters stehende Legitimation verschaffen. Zu diesem Zweck reiste Napoléon im September 1804 nach Aachen und besuchte den Dom und das Grab Karls des Großen.
Napoléons Tun wurde in Wien, der Residenz des Kaisers des Reiches, genau registriert. In den auf die Annahme des Kaisertitels folgenden diplomatischen Gesprächen zwischen Frankreich und Österreich forderte Napoleon am 7. August 1804 in einer geheimen Note die Anerkennung seines Kaisertums, im Gegenzug werde Franz II. als „Empereur héréditaire d’Autriche”, als „Erbkaiser Österreichs” anerkannt. Wenige Tage später wurde aus der Forderung faktisch ein Ultimatum. Dies bedeutete entweder Krieg oder Anerkennung des französischen Kaisertums. Franz lenkte ein und nahm am 11. August 1804 als Konsequenz dieses Schrittes zusätzlich zu seinem Titel als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches „für Uns und Unsere Nachfolger […] den Titel und die Würde eines erblichen Kaisers von Österreich” an. Dies geschah offensichtlich, um die Ranggleichheit mit Napoléon zu wahren. Hierzu schien der Titel des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches allein nicht mehr geeignet, auch wenn dies wohl ein Bruch des Reichsrechts war, da er weder die Kurfürsten über diesen Schritt informierte noch den Reichstag um Zustimmung bat.
Dieser Schritt war auch vom Rechtsbruch abgesehen umstritten und wurde als übereilt angesehen, wie ein Brief von Friedrich Gentz, einem bekannten österreichischen Publizisten, an seinen Freund Fürst von Metternich deutlich macht:
Bleibt die deutsche Kaiserkrone im österreichischen Hause – und welche Unmaßen von Unpolitik schon jetzt, wo noch keine dringende Gefahr vorhanden, öffentlich zu erkennen zu geben, daß man das Gegenteil befürchtet! – so ist jene Kaiserwürde ganz unnütz
Napoleon ließ sich jedoch nicht mehr aufhalten. Im Dritten Koalitionskrieg marschierte seine Armee, die durch bayerische, württembergische und badische Truppen verstärkt wurde, auf Wien zu und am 2. Dezember 1805 siegten die napoleonischen Truppen in der Dreikaiserschlacht bei Austerlitz über Russen und Österreicher. Der darauffolgende Frieden von Preßburg, der Franz II. und dem russischen Zaren Alexander I. von Napoleon diktiert wurde, dürfte das Ende des Reiches endgültig besiegelt haben, da Napoleon durchsetzte, dass Bayern, Württemberg und Baden mit voller Souveränität ausgestattet wurden und somit mit Preußen und Österreich gleichgestellt wurden. Diese Länder befanden sich nun faktisch außerhalb der Reichsverfassung.
Dies unterstreicht eine Äußerung Napoleons gegenüber seinem Außenminister Talleyrand:
Es wird keinen Reichstag mehr geben; denn Regensburg soll Bayern gehören; es wird auch kein Deutsches Reich mehr geben.
Letzter Anstoß für die Niederlegung der Krone war jedoch, dass der Kurfürst von Mainz, Karl Theodor von Dalberg, den Großalmosenier des französischen Kaiserreiches, Joseph Kardinal Fesch, zu seinem Koadjutor mit dem Recht der Nachfolge ernannte. Brisant war dabei, dass Dalberg außerdem Erzkanzler des Reiches und damit Haupt der Reichskanzlei, Aufseher des Reichsgerichtes und Hüter des Reichsarchivs war. Der zu seinem Nachfolger ernannte Kardinal war zudem nicht nur Franzose und sprach kein Wort deutsch – er war auch der Onkel Napoléons. Wäre also der Kurfürst gestorben oder hätte sonst irgendwie seine Ämter abgegeben, so wäre der Onkel des französischen Kaisers Erzkanzler des Reiches geworden. Am 28. Mai 1806 wurde der Reichstag davon in Kenntnis gesetzt.
Der österreichische Außenminister Johann Philipp von Stadion erkannte die möglichen Folgen: entweder die Auflösung des Reiches oder eine Umgestaltung des Reiches unter französischer Herrschaft. Daraufhin entschloss sich Franz am 18. Juni zu einem Protest, der wirkungslos blieb, zumal sich die Ereignisse überschlugen:
Am 12. Juli 1806 gründeten Kurmainz, Bayern, Württemberg, Baden, Hessen-Darmstadt, Nassau, Kleve-Berg und weitere Fürstentümer mit Unterzeichnung der Rheinbundakte in Paris den Rheinbund, als dessen Protektor Napoleon fungierte, und erklärten am 1. August den Austritt aus dem Reich.
Bereits im Januar hatte der schwedische König die Teilnahme der vorpommerschen Gesandten an den Reichstagssitzungen suspendiert und erklärte als Reaktion auf die Unterzeichnung der Rheinbundakte am 28. Juni, dass in den zum Reich gehörenden Ländern unter schwedischer Herrschaft die Reichsverfassung aufgehoben und die Landstände und Landräte aufgelöst seien. Er führte stattdessen die schwedische Verfassung in Schwedisch-Pommern ein. Damit beendete er auch in diesem Teil des Reiches das Reichsregime. Das Reich hatte faktisch aufgehört zu existieren, denn von ihm blieb nur noch ein Torso übrig.
Die Entscheidung, ob der Kaiser die Reichskrone niederlegen sollte, wurde durch ein Ultimatum an den österreichischen Gesandten in Paris, General Vincent, praktisch vorweggenommen. Sollte Kaiser Franz bis zum 10. August nicht abdanken, dann würden französische Truppen Österreich angreifen, so wurde diesem am 22. Juli mitgeteilt.
In Wien waren jedoch schon seit mehreren Wochen Johann Aloys Josef Freiherr von Hügel und Graf von Stadion mit der Erstellung von Gutachten über die Bewahrung der Kaiserwürde des Reiches befasst. Ihre nüchterne und rationale Analyse kam zu dem Schluss, dass Frankreich versuchen werde, die Reichsverfassung aufzulösen und das Reich in einen von Frankreich beeinflussten föderativen Staat umzuwandeln. Sie folgerten, dass die Bewahrung der „Reichsoberhauptlichen Würde” unvermeidlich zu Schwierigkeiten mit Frankreich führen würde und deshalb der Verzicht auf die Reichskrone unumgänglich sei.
Der genaue Zeitpunkt dieses Schrittes sollte nach den politischen Umständen bestimmt werden, um möglichst vorteilhaft für Österreich zu sein. Am 17. Juni 1806 wurde dem Kaiser das Gutachten vorgelegt. Den Ausschlag für eine Entscheidung des Kaisers gab jedoch wohl das erwähnte Ultimatum Napoleons. Am 30. Juli entschied sich Franz, auf die Krone zu verzichten; am 1. August erschien der französische Gesandte La Rochefoucauld in der österreichischen Staatskanzlei. Erst nachdem der französische Gesandte nach heftigen Auseinandersetzungen mit Graf von Stadion formell bestätigte, dass sich Napoléon niemals die Reichskrone aufsetzen werde und die Unabhängigkeit Österreichs respektiere, willigte der österreichische Außenminister in die Abdankung ein, die am 6. August verkündet wurde.

Der Reichsapfel des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation in der Schatzkammer in Wien gehört zu den Reichskleinodien.
Zusammen mit den Insignien der Macht, der Krone und dem Zepter, wurde er dem König oder dem Kaiser während der Krönungszeremonie überreicht.
In der Abdankung heißt es, dass der Kaiser sich nicht mehr in Lage sieht seine Pflichten als Reichsoberhaupt zu erfüllen, und dementsprechend erklärte er:
[…], daß Wir das Band, welches Uns bis jetzt an den Staatskörper des deutschen Reichs gebunden hat, als gelöst ansehen, daß Wir das reichsoberhauptliche Amt und Würde durch die Vereinigung der conföderirten rheinischen Stände als erloschen und Uns dadurch von allen übernommenen Pflichten gegen das deutsche Reich losgezählt betrachten, und die von wegen desselben bis jetzt getragene Kaiserkrone und geführte kaiserliche Regierung, wie hiermit geschieht, niederlegen.
Und der Kaiser überschritt ein letztes Mal seine Kompetenzen als Reichsoberhaupt. Franz legte nicht nur die Krone nieder, sondern er löste das Reich als Ganzes auf, hierzu wäre aber die Zustimmung des Reíchstages nötig gewesen, denn er verkündete auch:
Wir entbinden zugleich Churfürsten, Fürsten und Stände und alle Reichsangehörigen, insonderheit auch die Mitglieder der höchsten Reichsgerichte und die übrige Reichsdienerschaft, von ihren Pflichten, womit sie an Uns, als das gesetzliche Oberhaupt des Reichs, durch die Constitution gebunden waren.
Er löste auch die zu seinem eigenen Herrschaftsbereich gehörenden Länder des Reiches aus diesem heraus und unterstellte sie allein dem österreichischen Kaisertum.
Auch wenn die Auflösung des Reiches wohl juristisch nicht haltbar war, fehlte es am politischen Willen und auch an der Macht, das Reich zu bewahren.
Wiener Kongress und Deutscher Bund
Nach dem Wiener Kongress im Jahre 1815 schlossen sich die deutschen Einzelstaaten zum Deutschen Bund zusammen. Zuvor, im November 1814, richteten jedoch 29 Souveräne kleiner und mittlerer Staaten folgenden Wunsch an den Kongress:
die Wiedereinführung der Kaiserwürde in Deutschland bei dem Komitee, welches sich mit der Entwerfung des Planes zu einem Bundesstaat beschäftigt, in Vorschlag zu bringen.
Grundlage dieser Petition dürfte kaum patriotischer Eifer gewesen sein. Eher kann davon ausgegangen werden, dass diese die Dominanz der durch Napoléon zu voller Souveränität und Königstiteln gelangten Fürsten, beispielsweise der Könige von Württemberg, Bayern und Sachsen, fürchteten.

Delegierte des Wiener Kongresses in einem zeitgenössischen Kupferstich (koloriert)
von Jean Godefroy nach dem Gemälde von Jean-Baptiste Isabey
Aber auch darüber hinaus wurde die Frage, ob ein neuer Kaiser gekürt werden solle, diskutiert. So existierte u.a. der Vorschlag, dass die Kaiserwürde zwischen den mächtigsten Fürsten im südlichen Deutschland und dem mächtigsten Fürsten in Norddeutschland alternieren solle. Im Allgemeinen wurde jedoch von den Befürwortern des Kaisertums eine erneute Übernahme der Kaiserwürde durch Österreich, also durch Franz I., favorisiert.
Da aber auf Grund der geringen Macht der Befürworter der Wiederherstellung, der kleinen und mittleren deutschen Fürsten, nicht zu erwarten war, dass der Kaiser in Zukunft die Rechte erhielte, die diesen zu einem tatsächlichen Reichsoberhaupt machen würden, lehnte Franz die angebotene Kaiserwürde ab. Dementsprechend betrachteten Franz I. und sein Kanzler Metternich diese in der bisherigen Ausgestaltung nur als eine Bürde. Auf der anderen Seite wollte Österreich aber den Kaisertitel für Preußen oder einen anderen starken Fürsten nicht zulassen.
Der Wiener Kongress ging auseinander, ohne das Kaisertum erneuert zu haben. Daraufhin wurde am 8. Juni 1815 der Deutsche Bund als lockere Verbindung der deutschen Staaten gegründet. Österreich führte den Deutschen Bund bis 1866 als Präsidialmacht.
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Heiliges Römisches Reich aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.