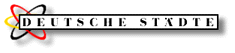Der Potsdamer Platz in Berlin: Verdienter Touristen-Hotspot oder eher überbewertet?
1. August 2025
Wer ihn zum ersten Mal sieht, könnte meinen, mitten in einem Architekturmuseum der Jahrtausendwende gestolpert zu sein und das mitten in Berlin. Der Potsdamer Platz wirkt wie ein Ort, der sich ständig neu erfinden will, ohne genau zu wissen, was er eigentlich sein möchte. Hochglanz trifft hier auf Erinnerung, Stahl auf Spuren der Geschichte, und mittendrin steht ein städtebauliches Großprojekt, das bis heute polarisiert.

Berlin – Foto von Levin auf Unsplash
Die bewegte Vergangenheit eines Platzes
In den Zwanziger Jahren war der Potsdamer Platz so etwas wie das schlagende Herz der Stadt. Ein Verkehrsknotenpunkt, ein Treffpunkt der feinen Gesellschaft und des Berliner Alltags, ein Ort, an dem Tag und Nacht Leben pulsierte.
Taxis, Pferdekutschen, Menschenmengen. Wer hier stand, bekam ein Gespür für Tempo und Moderne. Kein Wunder, dass hier 1924 Europas erste Verkehrsampel aufgestellt wurde und die wurde dringend gebraucht. Bis zu 20.000 Autos pro Tag drängelten sich über den Platz, flankiert von über 80.000 Fahrgästen, die den nahen Bahnhof nutzten.
Dann kam der Krieg. Die Bombennächte machten aus dem einstigen Vorzeigeplatz ein Trümmerfeld. Gebäude verschwanden, Fassaden stürzten ein, das urbane Flair löste sich in Staub auf. Was blieb, war eine Brache, grau, leer und still. Mit dem Mauerbau 1961 wurde dieser Stillstand zementiert. Der Potsdamer Platz verwandelte sich in eine bizarre Grenze, durchzogen von Beton, Stacheldraht und Kontrollpunkten. Wer dort stand, stand nicht auf einem Platz, er stand in einem Nichts. Einem Niemandsland, das jahrelang unzugänglich blieb. Erst der Fall der Mauer brachte Bewegung zurück. Doch diese Rückkehr ins Leben war kein natürlicher Prozess, sie war ein Kraftakt.
Ein Beispiel dafür, wie sich der Platz seither gewandelt hat, ist die Spielbank Berlin direkt am Potsdamer Platz. Sie zählt heute zu den bekanntesten Spielbanken Deutschlands und lockt mit klassischer Casino-Atmosphäre. Moderne Spiele wie etwa Plinko, die online längst beliebt sind, sucht man dort allerdings vergeblich. Ein Blick ins Netz auf Seiten wie https://www.wette.de/online-casino/plinko/ zeigt, wie solche Alternativen heute aussehen. Trotzdem bleibt die Spielbank ein fester Bestandteil des Areals und ein Symbol dafür, wie sich Tradition und neue Unterhaltungskulturen in Berlin immer wieder neu begegnen.
Wie Berlin aus einer Brache ein Symbol für die Zukunft machen wollte
Nach 1989 war klar, diese zentrale Leerstelle konnte nicht bleiben, wie sie war. Der Berliner Senat öffnete das Areal für Investoren, internationale Architekturgrößen wurden eingeladen, eine Vision für das neue Berlin zu erschaffen. Ein Berlin, das sich nicht mehr hinter Mauerresten versteckte, sondern mit offenen Fassaden in die Welt blickte.
Das Ergebnis ist ein Masterplan von Renzo Piano, getragen von Namen wie Helmut Jahn, Hans Kollhoff und Richard Rogers. Mit Daimler-Benz, Sony und Otto Beisheim kamen potente Geldgeber ins Spiel. Ihre Aufgabe ist nicht weniger als die Wiedergeburt eines Stadtzentrums. Auf über 60 Hektar Fläche entstand bis 2000 ein komplett neues Viertel.
Hochhäuser, Einkaufszentren, Kinos, Wohnblöcke. Alles am Reißbrett geplant, alles mit internationalem Anspruch. Kein Pflasterstein blieb dem Zufall überlassen. Hier sollte sichtbar werden, dass Deutschland wieder wer war und Berlin die Hauptstadt dazu.
Glanz aus Glas und Beton
Wer ein Faible für Architektur hat, kann am Potsdamer Platz durchaus auf seine Kosten kommen. Da wäre etwa das Sony Center mit seinem spektakulären Zeltdach, das bei Nacht in wechselnden Farben leuchtet und mit seiner offenen Plaza ein futuristisches Ambiente schafft. Gestaltet wurde es von Helmut Jahn, der sich vom japanischen Fujisan inspirieren ließ. Kein Scherz, sondern Konzept. Kinos, Restaurants und das Museum für Film und Fernsehen sorgen im Inneren für Beschäftigung.
Gleich nebenan ragt der Kollhoff-Tower empor. Ein Backsteinmonolith mit 103 Metern Höhe, der sich architektonisch an den expressionistischen Baustil der 1920er-Jahre anlehnt. Von seiner Spitze aus lässt sich Berlin aus der Vogelperspektive erleben. Der schnellste Aufzug Europas bringt einen in Windeseile hinauf zum Panoramapunkt.
Auch der Bahntower macht Eindruck. Mit seiner ovalen Form, der durchgängigen Glasfassade und einer Höhe von 103 Metern zählt er zu den auffälligsten Hochhäusern Berlins. Einst Sitz der Deutschen Bahn, heute ein Bürokomplex mit wechselnden Mietern.
Eher leise, aber nicht minder bemerkenswert ist das Haus Huth. Ein unscheinbares Gebäude, das als einziges Vorkriegsgebäude die Zerstörungen überstanden hat und das nur, weil es eine Stahlkonstruktion besaß. Heute steht es wie ein Mahnmal zwischen all den Neubauten. Fast trotzig, fast verloren.
Ein Ort, der Freizeit und Kultur zugleich sein will
Das Viertel versucht, alles zu sein, von Erlebnismeile, über Kulturzentrum bis hin zu Shopping-Paradies und tatsächlich ist das Angebot so vielfältig wie die Fassade des Sony Centers. Im Spionagemuseum können Besucher tief in die Welt der Agenten eintauchen, von der Stasi bis zur NSA. Im Museum für Film und Fernsehen begegnet man Marlene Dietrichs Kleidern, alten DEFA-Streifen und modernen Produktionen.
Gleichzeitig buhlen zahlreiche Kinos um Aufmerksamkeit. Die Berlinale nutzt den Potsdamer Platz regelmäßig als Bühne, Premieren mit Blitzlichtgewitter inklusive. Wer es ruhiger mag, kann in einem der vielen Cafés versacken oder in der Mall of Berlin nach Schnäppchen jagen.
Warum viele mit dem Potsdamer Platz fremdeln
Kaum ein Ort in Berlin spaltet so sehr wie der Potsdamer Platz. Für die einen ist er eine bauliche Meisterleistung, für die anderen ein seelenloses Einkaufszentrum mit Hochhausfassade. Der Begriff „Nicht-Ort“ fällt häufig, wenn es um die Atmosphäre geht.
Wer nach Berliner Schnauze, verwinkelten Hinterhöfen oder Kiezleben sucht, ist hier schlicht falsch. Stattdessen gibt es Security-Männer in schwarzen Westen, Designermode, Luxus-Apartments und ein Publikum, das schnell wieder weiterzieht.
Kreuzberg, Neukölln oder Prenzlauer Berg wirken im Vergleich wie ein anderes Universum. Dort regiert die Spontanität, das Ungeplante, das Persönliche und hier sind es Kontrolle, Ordnung und Hochglanz. Kein Wunder, dass viele Berliner den Potsdamer Platz meiden. Er gehört nicht zu den Kiezen, sondern zu den Kulissen.
Was vom Potsdamer Platz bleibt
Der Potsdamer Platz bleibt ein Platz der Widersprüche. Er steht für Aufbruch und Verlust, für Innovation und Beliebigkeit. Er funktioniert, wenn man ihn als Eventfläche, als architektonisches Statement oder als Touristenmagnet betrachtet. Er enttäuscht, wenn man von ihm Wärme, Geschichte oder echtes Berliner Lebensgefühl erwartet. Was also bleibt ist vielleicht genau das, die Erkenntnis, dass Städte Orte wie diesen brauchen. Als Versuchslabore, als Projektionsflächen, als Mahnung, wie schwer es ist, urbanes Leben am Reißbrett zu entwerfen und manchmal reicht das schon, um ihn nicht einfach als überbewertet abzutun.