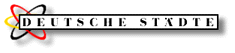Stilvoller Stadtboden: Warum Terrazzo bei der Altbausanierung wieder im Trend liegt
5. Juni 2025
In Berliner Gründerzeitwohnungen, Leipziger Cafés und renovierten Hamburger Kontoren taucht er immer häufiger wieder auf: der Terrazzo-Boden. Was früher als „Bauhaus-Relikt“ galt, ist heute gefragter denn je. Warum entscheiden sich immer mehr Architekturbüros, Denkmalpfleger und Stadtentwickler für einen Bodenbelag, der auf einer jahrhundertealten Technik beruht? Und was macht ihn ausgerechnet jetzt, im Zeitalter von Klicklaminat und Betonoptik, zur ästhetischen Replik urbaner Authentizität? Die Antwort liegt im Spannungsfeld von Material, Geschichte und Moderne.

Terrazzo – Bild von Karolina Grabowska auf Pixabay
Altbauten fordern andere Lösungen
Sanieren bedeutet oft mehr als nur Dämmen und Fenster tauschen. In historischen Gebäuden geht es auch um Atmosphäre, um Materialehrlichkeit und um den Erhalt von Substanz. Wer eine Stadtvilla oder ein ehemaliges Kontorhaus renoviert, wird früher oder später mit der Frage konfrontiert: Was kommt auf den Boden? Echtholzdielen? Zu empfindlich. Fliesen? Oft zu steril. Parkett? Passt nicht zu jedem Raum. Genau hier beginnt die Renaissance des Terrazzo.
Ursprünglich aus Venedig stammend, wurde Terrazzo im 20. Jahrhundert zum festen Bestandteil öffentlicher Gebäude – von Schulen über Rathäuser bis hin zu Bahnhöfen. Heute erlebt der Werkstoff sein Comeback in urbanen Wohn- und Geschäftsräumen. Moderne Herstellungsverfahren machen ihn dabei nicht nur robuster, sondern auch zugänglicher. Wer keinen eigenen Steinmetz beauftragen möchte, kann beispielsweise eine Terrazzo Fertigmischung verwenden – ideal für kleinere Flächen oder punktuelle Sanierungen im Bestand.
Nachhaltigkeit als Vorteil
Terrazzo ist zudem ein echtes Langzeitprodukt: Bei sachgemäßer Verarbeitung und Pflege liegt die Lebensdauer bei über 50 Jahren – deutlich länger als bei den meisten modernen Bodenbelägen. Dank seiner mineralischen Zusammensetzung ist der Belag außerdem feuerfest, antistatisch und emissionsfrei – wichtige Argumente gerade bei öffentlichen Gebäuden oder denkmalgerechten Sanierungen. Auch beim Thema Nachhaltigkeit punktet Terrazzo: Er besteht größtenteils aus natürlichen oder recycelten Materialien wie Zement, Marmorbruch und Farbpigmenten.
Was Architekten an Terrazzo lieben
Für viele Planer ist Terrazzo mehr als ein ästhetisches Statement – er ist ein funktionales Multitalent. Der fugenlose Aufbau erlaubt es, Flächen optisch zu weiten. Besonders in Fluren, Treppenhäusern oder großen Wohnküchen entfaltet der Boden seine Wirkung. Dabei punktet er nicht nur visuell. Auch technisch bringt Terrazzo handfeste Vorteile: hohe Druckfestigkeit, gute Wärmeleitfähigkeit, geringe Abnutzung. Wer einmal barfuß über einen echten Terrazzo gelaufen ist, kennt den Unterschied.
Hinzu kommt die gestalterische Freiheit. Unterschiedlichste Zuschlagstoffe – von Marmor über Glas bis zu recyceltem Ziegel – lassen sich einarbeiten. So entsteht mit jedem Boden ein Unikat. Besonders in Kombination mit modernen Möbeln, Lichtkonzepten und offener Architektur wirkt Terrazzo nicht altmodisch, sondern zeitlos. Kein Wunder also, dass er längst nicht mehr nur in Altbauten verwendet wird, sondern auch in Neubauprojekten auftaucht – als bewusster Stilbruch.
Pflegeaufwand? Ein weitverbreiteter Irrtum
Ein häufiger Mythos rund um Terrazzo lautet: „Wunderschön, aber extrem pflegeintensiv.“ Diese Vorstellung hält sich hartnäckig – zu Unrecht. Tatsächlich ist Terrazzo weitaus pflegeleichter, als viele vermuten. Moderne Versiegelungen und Imprägnierungen machen ihn heute deutlich widerstandsfähiger gegen Flecken, Kratzer und Feuchtigkeit als frühere Varianten. Wer beim Einbau auf eine fachgerechte Oberflächenbehandlung achtet, kann den Boden im Alltag mit einem einfachen Wischsystem sauber halten – ganz ohne Spezialreiniger oder stundenlanges Polieren.
Selbst in stark frequentierten Bereichen wie Hauseingängen, Ladengeschäften oder Cafés bewährt sich Terrazzo als belastbarer, langlebiger Untergrund. Und sollte nach vielen Jahren doch eine matte Stelle auftreten? Dann lässt sich die Oberfläche abschleifen und neu versiegeln – ganz ohne Komplettaustausch. Dieser Aspekt macht Terrazzo nicht nur nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich attraktiv: Ein Boden, der nicht ersetzt, sondern einfach „erneuert“ werden kann, spart langfristig Material, Arbeit und Ressourcen.